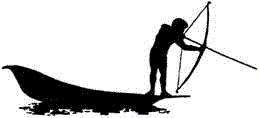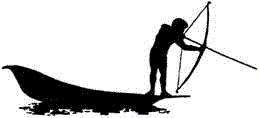 |
Die Wächter der
Wälder
"Unsere Zukunft ist eure Zukunft"
Eine Unterrichtseinheit
über indigene Völker, Klimabündnis und wir, Mai
2000
Gesellschaft für
bedrohte Völker - Südtirol
Landesamt für Luft und Lärm, Autonome Provinz
Bozen
Pädagogisches Institut Bozen
|
INHALT
 Eingedämmte Umwelt
Eingedämmte Umwelt
Dammbauten,
besonders Superdämme, können die ganze Ökologie
einer Region verändern. Natürliche Ressourcen
verschwinden unter Wasser, auch Jagdgründe und Ackerland,
während Erdrutsche Flutwellen und weitreichende
Überschwemmungen verursachen
können.
a) Das Wasser im
Staubecken kann durch Schwefelwasserstoff, der von faulenden
Pflanzen ausgeschieden wird, und durch dioxinhaltige, zur
Vernichtung der Vegetation eingesetzte Pflanzengifte verseucht
werden.
b) Hinter der
Staumauer abgelagerter Schlamm hemmt die Bewegungsfreiheit der
Fische und verkürzt die Lebensdauer des
Dammes.
c) Da die Technologie
großer Dammbauten noch in den Kinderschuhen steckt, bleibt
die Dammbruchgefahr bestehen, während zusätzliche
Versalzung und ausbleibende Schlammdüngung die Böden
flußabwärts erschöpft.
d) Der Damm, die
lnfrastruktur und die Ansiedler lassen den Eingeborenen wenig
Land übrig
aus:
GfbV-Unterrichtseinheit "Wir leben im Schoß des Waldes -
der Kampf der Adivasi am Narmada-Fluß in
Indien"
 Staudämme gegen die Wächter der
Erde
Staudämme gegen die Wächter der
Erde
In den
Entwicklungsländern, wo Wasserkraft heute mehr als 40
Prozent des Stroms liefert, erscheinen Staudämme als
Schlüssel zur wirtschaftlichen Entwicklung. Sie bieten eine
unerschöpfliche Energiequelle für Großstädte
und Industrie, beruhend auf natürlichen Ressourcen und einer
Technologie, die scheinbar weniger schädlich ist als Atom-
oder Kohlekraftwerke. Und als Nebenprodukte fallen eine
gesicherte Trinkwasserversorgung und ein Ausbau der
Bewässerung ab.
Doch für die
Eingeborenen kann der Preis verheerend sein. Dammbauten machen
Tausende, manchmal Hunderttausende heimatlos, sie überfluten
heilige Stätten, vernichten Dörfer und
überschwemmen fruchtbare Böden und
Wälder.
Dammbauten
verursachen weitere Folgekosten, die gegen die Vorteile ins
Gewicht fallen. Sie verringern die Anschwemmung
nährstoffreichen Schlamms und machen weite Gebiete
unfruchtbar. Sie schaffen Stauseen, wo die Vegetation fault und
giftige Schwefelwasserstoffe emittiert. Sie stören die
Ökosysteme der Gewässer und verringern die Fauna und
Flora der Flüsse. Sie blockieren die jahreszeitlichen
Fischwanderungen flußauf und hinterlassen künstliche
Brackwasserseen, die oft zur Brutstätte von Krankheiten wie
Malaria und Blutegelfieber werden.
Neue Straßen
verlangen noch mehr Waldrodung, und herangeholte Bauarbeiter
schleppen Krankheiten ein und setzen einen Prozeß der
sozialen Auflösung in Gang. Häufig werden die
Eingeborenen von den Plänen, die der Staat mit ihnen hat,
gar nicht in Kenntnis gesetzt. Vom Kurku-Damm in Bihar (lndien)
erfuhren die Menschen dort erst, als die Baracken für die
Arbeiter aufgestellt wurden und die Landvermesser mit der
Meßlatte ihre Felder abzuschreiten begannen. Auch werden
sie meist nicht für ihre Verluste
entschädigt.
Außerdem
nützen Dammbauten letztlich nur einem kleinen Segment der
Bevölkerung, meistens der Industrie und den Bewohnern ferner
Städte - auf Kosten der Mehrheit vor Ort. Und obgleich
Superdämme billigen Strom für die Entwicklung des
Landes versprechen, erweisen sie sich langfristig als teure
Unternehmung. Nur wenige Dämme halten so lange wie erwartet,
da Stauseen versanden und Turbinen durch Vegetation blockiert
werden. Große Summen sind aufzuwenden, um unvorhergesehene
Überschwemmungen, um Versalzung und Dammbrüche
abzuwenden. In lndien ist fast ein Viertel des künstlich
bewässerten Landes durch Versumpfung oder Versalzung
vernichtet.
Aus: "Die
Wächter der Erde" von Julian Burger
 Flüsse
wieder renaturieren
Flüsse
wieder renaturieren
Institut verweist
auf Folgen durch Begradigung und Dämme
Eine
grundsätzliche Umorientierung der Gewässerpolitik hat
das US-amerikanische Worldwatch Institute gefordert.
Flußbegradigungen und Staudämme hätten weltweit
nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich negative
Auswirkungen, so die Umweltforscher in ihrer Studie. Seit 1950
sind nach Angaben des Instituts weltweit mehr als 30 000
große Staudämme gebaut worden, die höher sind als
15 Meter.
Derzeit vollziehe
sich in Süßwasserökosystemen ein noch nie
dagewesenes Artensterben. Weltweit seien 20 Prozent der 9000
Fischarten ausgestorben oder bedroht, in Europa und Nordamerika
40 Prozent. Der Verlust sei auf Verschmutzung der Gewässer
und auf Baumaßnahmen zurückzuführen. In vielen
Flüssen sei die Fischwirtschaft zum Erliegen gekommen, so im
Columbia- River im Nordwesten der USA.
Auch im Missouri und
im Rhein sei das Fischereiwesen stark beeinträchtigt.
Flußbegradigungen, Dämme, Zubetonieren der
Uferlandschaften und Entwaldung seien für
Überschwemmungen verantwortlich, so Worldwatch.
Paradebeispiel sei der Rhein. In Deutschland habe das letzte
Hochwasser Schäden im Wert von 1,6 Milliarden Mark
angerichtet. Die immer häufiger auftretenden
Rheinüberschwemmungen seien das Resultat der praktizierten
Baupolitik, die den Strom um 100 km verkürzt habe. Der
Fluß fließe über weite Strecken zwischen Beton,
ein Schleusen- und Dammsystem habe ihn zur
Schiffschnellstraße umfunktioniert. Auch das Hochwasser am
Missouri und Mississippi von 1993, die größte
Überschwemmung der US-Geschichte, sei darauf
zurückzuführen.
Janet Abramowitz,
Autorin der Studie, bedauerte, daß die Dritte Welt nichts
von den Fehlern Europas und der USA lerne. So seien derzeit am
südostasiatischen Mekong, den südamerikanischen
Paraguay- und Parana-Flüssen und in China verheerende
Dammprojekte im Bau- oder Planungsstadium. Auf Dauer wäre es
das Beste, wenn die natürlichen
Süßwasserökosysteme erbalten blieben. Vielerorts
wäre es möglich, Flüsse zu ihren natürlichen
Wegen zurückkehren zu lassen.
Aus:
GfbV-Unterrichtseinheit "Wir leben im Schoß des Waldes -
Der Kampf der Adivasi am Narmada-Fluß in
Indien"
 Adivasi -
indische Stammesvölker
Adivasi -
indische Stammesvölker
Das Hindi-Wort
Adivasi bedeutet ,,die ersten Bewohner". Es wird wohlwollend als
Sammelbegriff für alle Stammesangehörigen gebraucht.
Niemand weiß genau, warum die "arischen" Hirtenstämme
ihre zentralasiatische Heimat verließen. Als sie aber in
mehreren Wellen im Zeitraum von 1.500 bis 500 v. Chr. die
nordindischen Flußebenen erreichten, erlebte ihre Kultur
einen grandiosen Entwicklungssprung. Die hellhäutigen
Nomaden wurden zu seßhaften Bauern. Sie
institutionalisierten mit dem Kastensystem die Versklavung der
Urbevölkerung. Jene dunkelhäutigen Ureinwohner, die in
den Dienst der neuen Herrn traten und von ihnen beherrscht
wurden, blieben und bleiben als sogenannte Unberührbare von
der Gesellschaft ausgeschlossen.
Die
ursprünglichen Bewohner des indischen Subkontinents,
verschiedene Stämme, lebten bis dahin unbehelligt als
Jäger und Sammler oder auch Wanderfeldbauern in den
Wäldern, die damals den gesamten Kontinent bedeckten. Einige
Volksgruppen gerieten in die Abhängigkeit der "arischen"
Eroberer, andere dagegen zogen sich in unwegsame Gebiete
zurück, um ihre Autonomie zu wahren. Der
Rückzugsprozeß der indischen Stammesbevölkerung
ist erst im 20. Jahrhundert zum Stillstand gekommen, weil es fast
keine Wildnis mehr gibt.
Wirtschaftsformen und
Lebensarten
Die Volkszählung
des Jahres 1971 hat 255 verschiedene Stammesvölker
registriert. Heute leben Adivasi in jeder Region lndiens, auch in
den Großstädten. lhre Siedlungsschwerpunkte aber
liegen in den Bergregionen. In den Vorbergen des Himalaya-Massivs
und im Grenzgebiet zu Birma leben hauptsächlich mongolide
Stämme. Das ausgedehnte Hügelgebiet Chota Nagpur
(Jharkhand) westlich von Kalkutta ist die Heimat der
Munda-Stämme und vieler dravidischer
Völker.
Die Adivasi nutzen
ökonomische und biologische Nischen, die von den
wirtschaftlich stärkeren Bevölkerungsgruppen als
unprofitabel betrachtet werden. Die Wirtschaft der
Stammesangehörigen ist stets auf Selbstversorgung
(Subsistenz) orientiert.
Jäger und
Sammler
Die älteste
Wirtschaftsform der Menschheit hat in einigen südindischen
Dschungelnklaven bis heute überlebt. Die Adivasi sind
geschickte Fallensteller und Fischer. Die fortschreitende
Zerstörung der Wälder zwingt sie heute jedoch,
Waldprodukte wie Honig, Wachs, Ölsamen und Brennholz gegen
Nahrungsmittel einzutauschen.
Wanderfeldbauern
In entlegenen
Berggebieten mit nährstoffarmen Böden ist der
Brandrodungsfeldbau die einzig mögliche Form der
Überlebens. Wenn der Boden nach zwei bis drei Ernten
ausgelaugt ist, muß ein neues Waldstück gerodet und
abgebrannt werden, muß zuweilen sogar das ganze Dorf
umziehen. Normalerweise kehrt die Dorfgemeinschaft erst nach 20
oder 30 Jahren zu den früheren Feldern zurück, wo sich
der Wald inzwischen wieder regeneriert hat. Weil Industrie und
Landwirtschaft immer mehr Wald verbrauchen, wird vielerorts eine
Verkürzung der Brachezeit notwendig, die eine Regeneration
des Pflanzenwuchses verhindert. Die meisten Unionsstaaten stellen
das Brandroden unter Strafe. Obwohl ursprünglich fast alle
indischen Stammesvölker Wanderfeldbauern waren, praktizieren
heute nur noch die Naga, Garo, Miri und andere Stämme im
Nordosten sowie die Madia-Gond und andere kleine Gruppen in den
Bergen an der Ostküste den Wanderfeldbau.
Kleinbauern
Die Mehrzahl der
Adivasi hat sich der bäuerlichen Hindubevölkerung
angepaßt. Als seßhafte Bauern sind sie es inzwischen
gewohnt, mit Pflug und Ochsen die Felder zu bestellen. Viele
dieser Kleinbauern haben allerdings in der jüngsten
Vergangenheit ihr Land an Nicht-Adivasi verloren und versuchen,
als Landarbeiter ein Auskommen zu finden.
Nomaden
Viele Händler-
und Hirtengemeinschaften sind als Stammesvölker organisiert.
Die Hirtenvölker folgen ihren Herden von der Sommer- zur
Winterweide. Auch die indischen Lambadi und Banjara, die mit den
europäischen Sinti und Roma verwandt sind, betrieben
ursprünglich Salzhandel. Heute ziehen sie als Musiker und
Gaukler, zunehmend auch als Wanderarbeiter, durchs
Land.
Fischer
Etwa die Hälfte
der sieben Millionen traditionellen Fischer an lndiens
Meeresküsten und Flüssen leben in
Stammesverbänden. Mit kleinen Holzbooten und uralten
Fangmethoden betreiben sie seit Jahrhunderten eine Ressourcen
schonende Fischereiwirtschaft. Die Fangergebnisse sind jedoch
durch die Wasserverschmutzung und die Konkurrenz der
motorisierten Trawlerflotten stark
rückläufig.
Kulis
Diejenigen
Stammesangehörigen, die durch die wirtschaftliche
Entwicklung ihre ursprüngliche Existenzgrundlage verloren
haben, müssen sich mit neuen Lebensformen vertraut machen.
Viele sind in die Slums der Städte abgewandert. Statt
Wurzeln und Beeren im Wald sammeln sie heute Papierfetzen und
Plastikreste von den Straßen auf. In ihrer Not verpflichten
sich viele Adivasi einem Vertragsunternehmer, der sie als
Tagelöhner auf Baustellen einsetzt. Millionen von Adivasi
arbeiten außerdem in den Teeplantagen von Assam und
Darjeeling.
Aus: "Selbst die
Götter haben sie uns geraubt" von Rainer
Hörig.
 Der
Überlebenskampf der Adivasi
Der
Überlebenskampf der Adivasi
Die 60 Millionen in
Indien lebenden Adivasi machen sieben bis acht Prozent der
Gesamtbevölkerung des Landes aus, knapp 20 Prozent der
Landesfläche werden vorwiegend von ihnen bewohnt. 414
Hauptstämme und eine größere Anzahl von
Unterstämmen sind als "Registrierte Stämme" staatlich
erfaßt. Die Absicht des indischen Staates, die Adivasi mit
der Mehrheitsgesellschaft zu verschmelzen, heißt im Grunde
nichts anderes als die Verdrängung der Adivasi. Legitimiert
wird das als Preis für den Fortschritt der Nation - ein
Preis, den die Adivasi zahlen müssen. So werden sie aus
ihren Wäldern und von ihrem Land
vertrieben.
Der Wald und die
Menschen
Der Wald war für
die Adivasi mehr als nur ihr Lebensraum, er war ihre Heimat, ja
ihre Religion. Sie verstanden den Wald als eine physische
Erweiterung ihrer selbst. Der indische Waldbestand, der 1971/72
noch 23 Prozent der Landesfläche ausmachte, war 1980 auf 17
Prozent zurückgegangen und beträgt heute nicht mehr als
9 Prozent mit einer jährlichen Entwaldungsquote von 1,5
Millionen Hektar. In wenigen Jahren wird es in lndien keine
Wälder mehr geben. Damit wäre im Namen des nationalen
Fortschritts die Lebensgrundlage der Adivasi
zerstört.
Die wissenschaftliche
Verwaltung der Waldressourcen war das Ziel der offiziellen
Forstpolitik von 1855, worauf die Einrichtung eines Imperial
Forest Department (Reichsforstbehörde) folgte. Ein 1864 von
der Regierung erlassenes Forstgesetz ermächtigte die
britische Kolonialregierung dazu, jedes mit Bäumen,
Unterholz oder Dschungel bedeckte Stück Land durch einfache
Verfügung zu Staatswald zu erklären und
Verstöße gegen diesen betreffende Bestimmungen unter
Strafe zu stellen. Hierauf kam es zu Aufständen der Adivasi.
Der ,,Bombay Forest Commission Report von 1887 zeigte die
Tragödie auf und verurteilte das Vorgehen von
Forstbehörde und Regierung.
lm ganzen Land
rebellierten die Adivasi-Gemeinschaften. lnzwischen war der Kampf
gegen die britische Kolonialherrschaft ins Rollen gekommen. Die
indische Kongresspartei INC, die den Kampf für die
Unabhängigkeit lndiens anführte, widersetzte sich der
britischen Forstpolitik und setzte sich für die Rechte der
Adivasi an den Wäldern ein. Dies war ein Teil ihrer
Strategie mit dem Ziel, die verschiedenen autonomen Kräfte
der Adivasi, die damals entstanden waren, für den
Unabhängigkeitskampf einzuspannen. Doch nach Erreichen der
Unabhängigkeit wurde just diese britische Forstpolitik
nahtlos vom neuen indischen Staat übernommen, nur daß
sie jetzt an Stelle der britischen den "nationalen lnteressen"
dienen sollte. 1952 formulierte die indische Regierung ihre
Forstpolitik ganz im Einklang mit derjenigen, die die Briten seit
1894 verfolgt hatten. Hierdurch wurden die Rechte der Menschen an
den von ihnen bewohnten Wäldern
beschnitten.
1976 sprach sich die
Nationale Landwirtschaftskommission für eine weitere
drastische Einschränkung der Rechte der Menschen aus, indem
sie viel Mühe darauf verwandte, für die Zerstörung
der Wälder ausgerechnet die Adivasi verantwortlich zu machen
und empfahl, noch strengere Gesetze für die Durchsetzung der
Forstpolitik zu erlassen. Auf dieser Grundlage wurde 1980 ein
Entwurf für ein neues Forstgesetz vorgelegt, das harte
Strafen für die Verletzung von Vorschriften vorsah und der
Forstbehörde nahezu richterliche Befugnisse gab.
Weitreichende Proteste von Adivasi, Adivasi-Unterstützern
und Menschenrechtsaktivisten konnten diese Pläne jedoch zu
Fall bringen. Schließlich erließ die indische
Regierung im Oktober 1980 eine Waldschutzverordnung, die es den
einzelnen Bundesstaaten untersagt, ohne vorherige Zustimmung der
Bundesregierung die Benutzung der Wälder für andere
Zwecke zu erlauben. Obwohl die neue nationale Forstpolitik die
symbiotische Beziehung der Adivasi zu ihrem Wald anerkennt, sieht
sie weder die wichtige Rolle, die diese als Bestandteil des
Waldökosystems spielen noch die Rechte, die ein derartiges
Verhältnis mit sich bringt. Die Adivasi gehören zum
Wald. Aber der Wald gehört nicht den
Adivasi.
Die Adivasi und
ihr Land
Die Waldbewohner sind
die einzigen Menschen in lndien, die praktisch keine
Eigentumsrechte haben, da sie den Forstgesetzen unterstehen.
Dabei widersprechen diese der indischen Verfassung, denn sie
verstoßen gegen eines der Grundrechte der Menschen - das in
Artikel 21 der Verfassung verankerte Recht auf
Leben.
Ein Bericht
der,,Nationalen Kommission zur Entwicklung
rückständiger Gebiete" über die Lage in den
Stammesgebieten wies 1981 deutlich darauf hin, daß der
Landraub an den Adivasi weiterginge. Dabei wurden u.a. folgende
Methoden angewendet: Übertragung von Adivasi-Land auf
Nicht-Adivasi auf dem Wege der Verpachtung oder der
hypothekarischen Belastung; Landkauf durch Nicht-Adivasi, welche
das Land unter dem Namen von Adivasi-Frauen registrieren lassen,
die sie als Mätressen halten; Verleihen von Namen von
Adivasi an Nicht-Adivasi gegen finanzielle Vorteile,
vorgetäuschte Adoption von Nicht-Adivasi durch
Adivasi-Familien unter der Beteiligung von Dorfbeamten;
Landerwerb durch den Staat für sogenannte
Entwicklungsprojekte (unter dem Landerwerbsgesetz von 1894 u.a.
wurden 300 verschiedene große, größere und
mittelgroße Staudämme in den dichten Urwäldern
gebaut, was zur Überflutung von Land und der Vertreibung von
Adivasi führte). Bergbau und andere lndustrien,
Naturreservate usw. haben weiter zur staatlich geförderten
Vertreibung beigetragen.
Nachdem sie erkannt
hatten, daß Landraub Destabilisierung bedeutet,
erließen viele Staaten Gesetze mit dem Ziel, den Adivasi
auf legale Weise das ihnen geraubte Land wieder
zurückzugeben. Nun ist es an den Adivasi, die Umsetzung der
von den Regierungen verschiedener Bundesstaaten verabschiedeten
Gesetze einzufordern, denn den Regierungen selbst dürfte aus
zweierlei Gründen nicht daran gelegen sein. Erstens sind die
Adivasi in den von ihnen bewohnten Gebieten zur Minderheit
geworden. Daneben fehlt ihnen noch die Organisation mit
politischem Durchsetzungsvermögen. Zweitens spielt der
Ressourcenreichtum der Adivasigebiete weiterhin eine wichtige
Rolle für den Staat und den Markt, und eine Stärkung
der Adivasi durch Rückgabe ihres Landes würde, so die
Befürchtungen, angesichts ihres wachsenden politischen
Selbstbewußtseins der Plünderung der Ressourcen im
Wege stehen.
Aus: Jai
Adibasi. A Political Reader on the Life and Struggle of
Indigenous Peoples in India von Sarini
 Staudämme am
Narmada-Fluss
Staudämme am
Narmada-Fluss
,,Wir bauen ein
Monument an der Narmada, um den hart arbeitenden Bauern die
seltene Freude einer reichen Ernte zu bescheren. Das
Sardar-Sarovar-Projekt wird das Gesicht Gujarats verändern."
Mit Anzeigen wie diesem, die im März 1989 in vielen
Tageszeitungen erschienen, versucht die Regierung von Gujarat das
Volk von den Vorteilen des Narmada-Staudammes zu überzeugen.
Nicht nur Strom für neue lndustrieansiedlungen, auch
dringend benötigtes Wasser für Landwirte und deren
Dörfer soll der Staudamm liefern. Die 100.000 Kleinbauern
und Pächter, in der Mehrzahl Adivasi, die dem Stausee
weichen sollen, führen jedoch andere Argumente ins Feld: die
Zerstörung kostbarer Ackerflächen und
Waldbestände, die Entwurzelung und Verelendung tausender
Familien, die umweltschädlichen Folgen einer auf
künstlicher Bewässerung und Pestizideinsatz beruhenden
kapitalintensiven Agrarwirtschaft.
In den letzten Jahren
ist das Staudammmprojekt im Narmadatal, das insgesamt 30
Großstaudämme, 135 mittlere und 3000 kleine Dämme
umfassen soll, zu dem am heftigsten umstrittenen
Entwicklungsprojekt Indiens avanciert. Die Auseinandersetzung
wird mit friedlichen Protesten, Gerichtseingaben und Resolutionen
auf der einen sowie Pressekampagnen, Verhaftungen und
Einschüchterungsversuchen auf der anderen, der
Regierungsseite, geführt.
Auch in lndien ist
das in den fünfziger und sechziger Jahren euphorisch
gefeierte Entwicklungskonzept der großtechnischen Projekte
in Verruf geraten. Sind die kostspieligen und von
ausländischer Hilfe abhängigen Großanlagen
wirklich für die Entwicklung des Landes unabdingbar, wie
Regierungssprecher immer wieder betonen? Der Journalist Sarosh
Bana, der sich in der Bürgerinitiative ,,People's Forum for
Water Utilisation" mit Fragen des Wassermanagements
beschäftigt, ist anderer Meinung: Natürlich gibt es
Alternativen zu Großstaudämmen. Man kann zum Beispiel
kleinere Bachläufe aufstauen und Bewässerungsteiche in
den Dörfern anlegen, um die Felder zu bewässern und
Trinkwasser zu speichern. Der Baliraja-Damm etwa, der vor kurzem
im Distrikt Sangli im Süden des Unionsstaates Maharashtra
von Dorfbewohnern in freiwilliger Zusammenarbeit erreicht wurde,
befriedigt die Bedürfnisse der Landbevölkerung, nicht
den Strombedarf irgendwelcher lndustrien oder weit entfernter
Großstädte. Es hat sich herausgestellt, daß
diese den Gegebenheiten vor Ort angepaßte Technik die
vorhandenen Ressourcen sehr effektiv ausnutzt, ohne jedoch
Umsiedlungen nötig zu machen oder verheerende
Umweltzerstörungen anzurichten.
Aus: "Selbst die
Götter haben sie uns geraubt" von Rainer
Hörig.
 Indiens
größtes Staudamm-Projekt
Indiens
größtes Staudamm-Projekt
Die Haltung der
Regierung
lndien gehört
heute zu den Ländern mit den meisten großen
Staudämmen und den größten
Bewässerungsflächen. Dammbauten und Bewässerung
haben eine jahrtausendealte Tradition in einigen Teilen des
Landes. Die geregelte Nutzung von Wasser war eine der
wesentlichen Vorbedingungen für das frühe Entstehen von
Hochkulturen auf dem indischen Subkontinent. Bis gegen Ende des
19. Jahrhunderts galt das Prinzip des geringstmöglichen
Eingriffs in die Natur, jedoch durch die gesteigerten
Bevölkerungswachstumsraten seit Anfang des 20. Jahrhunderts
wurde der Akzent mehr und mehr von der ,,Arbeit im Einklang mit
der Natur" hin zur ,,Beherrschung der Natur" verschoben. Indiens
langjähriger Ministerpräsident Nehru bezeichnete die
neuen Staudämme als die ,,Tempel des modernen
lndiens".
Die Narmada ist mit
ihren 1.312 Kilometern der zweitlängste Fluß lndiens,
gemessen an ihrer jährlichen Wassermenge ist sie der
siebtgrößte Fluß dieses Landes. Bis vor wenigen
Jahren floß ihr Wasser fast ungenutzt ins Meer ab und hat
während der Monsunperiode schon folgenschwere
Überschwemmungen verursacht. Die Niederschläge in
diesem Teil lndiens fallen zu über 90 Prozent in den vier
Monaten von Juni bis September. Dazu kommt, daß im
westlichen Teil der Narmada (im Grenzgebiet zu Rajasthan) die
jährliche Niederschlagsmenge derart niedrig ist, daß
selbst in guten Jahren die Ernte der Monsunfrucht ohne
Bewässerung höchst fragwürdig
ist.
Einige der
großen Dämme des Narmada-Projektes sollen zudem zur
Erzeugung von Strom dienen (Gesamtkapazität von mindestens
2.700 MW). Diese Energie soll nicht nur neuen lndustrien zugute
kommen, sondern auch der ländlichen Entwicklung
(Elektropumpen, Beleuchtung). Doch die bisherige Erfahrung zeigt
starke regionale Disparitäten bei der Stromvergabe- Strom
für Bewässerung hat Vorrang vor häuslichem
Verbrauch. Dies bedeutet für die Umsiedler mit ihren kleinen
Feldern von maximal 1,6 Hektar, daß sie keine
Elektrizität für ihre Dörfer im Hügelland
erhalten, während aller Strom für die Landwirtschaft in
das Bewässerungsgebiet der Ebene
fließt.
Wirtschaftliche
und ökologische Gegenargumente
Als Kriterium
für die Genehmigung großer Projekte gilt ein
Nutzen-Kosten-Verhältnis von 1,5 : 1. Oft jedoch wird diese
Relation zugunsten der Fortführung einmal begonnener
Projekte manipuliert. Z.B. erhöhten sich die
geschätzten Gesamtkosten für das Narmada-Sagar-Projekt
zwischen 1982 und 1986 von 4,2 Milliarden Rupees auf 13,9
Milliarden Rupees. Um das Projekt weiterverfolgen zu können,
wurde die geplante Anbauintensität im
Bewässerungsgebiet von 128 Prozent auf utopische 188 Prozent
erhöht.
Durch den durch das
Staudammprojekt entstandenen Wandel der Anbaustruktur von ,,food
crops" (auf Selbstversogung ausgerichteter Anbau) zu vermehrtem
Anbau von 15 "cash-crops" (auf die Bedürfnisse des
Weltmarktes ausgerichteter Anbau, in der Regel verbunden mit der
Entstehung riesiger Monokulturen) entstanden die bereits
bekannten erheblichen Einkommensdisparitäten. In der
Monsunperiode werden heute hauptsächlich Sojabohnen
angebaut, neben Reis die einzige Pflanze, die die hohe
Bodenfeuchtigkeit noch relativ gut ertragen kann. Die
Verarbeitung und Nutzung von Sojabohnen ist aber für den
Kleinbauern unmöglich; sie erfolgt in größeren,
neu geschaffenen lndustriebetrieben. Während die meisten
Bauern vor ihrer Umsiedlung fast ganzjährig in der
Landwirtschaft beschäftigt waren, ist dies an den
Umsiedlerorten nicht mehr möglich. Trotz
vorübergehender und zahlenmäßig begrenzter
Beschäftigungsmöglichkeiten im Wald und beim
Straßenbau sowie in den neugeschaffenen Milch- und
Fischereikooperativen hat sich die Tendenz zur saisonalen
Arbeitsmigration in die Küstenebene erheblich
verstärkt. Dort ist durch die Schaffung größerer
Monokulturen im Bewässerungsgebiet ein hoher kurzzeitiger
Erntearbeiterbedarf entstanden. Die Kooperativ-Produkte Milch und
Fisch werden jetzt in den größeren Städten
vermarktet, während sie früher von den Bauern
überwiegend selbst genutzt wurden.
Bis zur
endgültigen Realisierung des Narmada-Projektes sollen rund
350.000 Hektar Wald verlorengehen, darunter eines der
größten zusammenhängenden Teakwald- Gebiete
lndiens (rund 400 qkm). Neben den enormen Waldverlusten werden
auch erhebliche Verluste an teilweise wertvollen
Agrarflächen in der Flußniederung der Narmada zu
verzeichnen sein. Abgesehen vom Fehlen der Ablagerung des
fruchtbaren Flußschlamms im Hochflutbett der Narmada, das
in der Wintersaison landwirtschaftlich genutzt werden kann, wird
es auch zu einer schnelleren Schlammablagerung (Siltation) auf
dem Grund der Stauseen kommen, was deren Lebensdauer
gegenüber den Planzahlen erheblich verkürzen
kann.
Aus:
Indien-Rundbrief Januar 88 von Thomas
Methfessel
 IWF und
Weltbank
IWF und
Weltbank
Aufbau und
Funktion
Noch ehe der Zweite
Weltkrieg zu Ende war, gingen auf der "Währungs- und
Finanzkonferenz" im Juli 45 in Bretton Woods (USA) 45 Staaten
daran, die internationalen Wirtschaftsbeziehungen der
Nachkriegszeit zu ordnen. Sowohl der IWF, als auch die Weltbank
wurden auf der Grundlage der Abkommen dieser Konferenz 1945
gegründet.
Der
Internationale Währungsfonds (IWF)
Der IWF wurde mit dem
Ziel gegründet, dem Welthandel eine gesunde Finanzbasis zu
geben. Der IWF soll:
a) die Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der internationalen Währungspolitik
fördern:
b) ein ausgeglichenes
Wachstum des Welthandels fördern;
c) die
Stabilität der Währungen
fördern;
d) ein multilaterales
Zahlungssystem für laufende Transaktionen zwischen den
Mitgliedern einrichten und
e) Mitglieder bei der
Behebung von Zahlungsbilanzungleichgewichten
unterstützen.
Der Gouverneursrat
ist das oberste Entscheidungsgremium des Fonds, für den
jedes Mitgliedsland einen Gouverneur und einen Stellvertreter
benennt. Das Exekutivdirektorium entscheidet u.a. über
Kreditanträge und überprüft die Wirksamkeit der
mit den kreditnehmenden Ländern vereinbarten Auflagen. Die
Mitglieder des IWF mit den höchsten Quoten und den
größten Stimmrechten - USA, Großbritannien,
Deutschland, Frankreich und Japan - stellen jeweils einen
Exekutivdirektor.
Jedes Land stellt
entsprechend seiner Wirtschaftskraft eine Art Mitgliedsbeitrag.
Diese Gelder kann der IWF abrufen, um Mitgliedsländern
Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Gerät ein Land
kurzfristig in Zahlungsschwierigkeiten, kann es einen Kredit bis
zum Fünffachen der eigenen Quote beim IWF auf nehmen. Diese
Kredite werden als Sonderziehungsrechte bezeichnet. Für
langfristige Zahlungsschwierigkeiten, denen vor allem die
sogenannten Entwicklungsländer ausgesetzt sind, können
die Länder vom IWF dagegen nur Kredite bekommen, die an
strenge Bedingungen geknüpft sind.
Die
Weltbank
Die Weltbankgruppe
besteht aus drei wesentlichen Organisationen:
a) Der eigentlichen
,,Weltbank", der Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD
= lnternational Bank for Reconstruction and Development): Sie
wurde gegründet, um:
den Wiederaufbau und
die Entwicklung von Mitgliedsländern durch Erleichterung von
Kapitalanlagen für produktive Zwecke zu fördern;
private ausländische Investitionen sowie die
Produktionsquellen zu fördern.
b) Der
lnternationalen Finanz-Corporation (IFC): Die IFC wurde 1956 als
erste Schwesterorganisation der Weltbank gegründet.
Während die Weltbank Darlehen nur an Regierungen oder gegen
Regierungsgarantien (Bürgschaften) vergeben darf,
fördert die IFC private lnvestoren, die eine staatliche
Garantie wegen der damit möglicherweise verbundenen
staatlichen Einflußnahme ablehnen, oder wenn Regierungen
nicht bereit oder in der Lage sind, Garantien
abzugeben.
c) Der
Internationalen Entwicklungs-Organisation (IDA - lnternational
Development Organisation): Die IDA wurde 1960 als zweite
Schwesterorganisation der Weltbank gegründet. Sie vergibt
Darlehen zu günstigeren Bedingungen (keine oder nur geringe
Zinsen, wesentlich längere Laufzeiten) an die ärmsten
,,Entwicklungsländer". Dadurch soll die Realisierung von
wirtschaftlich wichtigen Projekten gewährleistet werden, die
sonst aufgrund der schwachen Finanzkraft und einer zumeist sehr
hohen Auslandsverschuldung dieser Länder nicht gegeben
wäre.
Mitglied der Weltbank
können nur Länder werden, die bereits Mitglied des IWF
sind. Die Kapitalanteile der Mitgliedsländer der Weltbank
basieren auf den Anteilen am IWF, welche unter Zugrundelegung der
relativen wirtschaftlichen Stärke der Länder festgelegt
werden. Die Stimmrechte hängen vom Kapitalanteil ab. Wie der
IWF hat die Weltbank einen Gouverneursrat, ein Direktorium,
außerdem einen Präsidenten und einen
Personalstab.
Die Projekte werden
in erster Linie nach wirtschaftlichen und technischen Kriterien
geprüft Eine Öffentlichkeitsbeteiligung, etwa in Form
von internationalen Naturschutzorganisationen, der örtlichen
Bevölkerung ... findet nicht statt, daher ist es
möglich, daß Großprojekte trotz gravierender
sozialer und umweltzerstörender Folgen realisiert
werden
Aus:
Unterrichtsmaterialien Tropischer Regenwald/Verlag die
Werkstatt
 Die
Richtlinie OD 4.20
Die
Richtlinie OD 4.20
Wie die Weltbank
lndigenen-Politik macht
Während
Jahrzehnten wurde die Weltbank von indigenen Völkern und
NGO's für die Finanzierung von Projekten kritisiert, die das
Leben indigener Völker zerstört haben. Die meisten
Menschen, einschließlich der am stärksten Betroffenen,
wären erstaunt zu erfahren, daß die Weltbank
während fast 15 Jahren eine Politik zum Schutz indigener
Völker verfolgt hat. Diese Politik geht zurück auf das
Jahr 1982. Damals erließ die Weltbank das "Operational
Manual Statement 2.34" über Stammesvölker, die von
Projekten der Institution betroffen sind. Die Leitung der
Weltbank hatte sie intern entwickeln lassen, um mit
Vorschlägen wie zum Straßenbau im Amazonasgebiet
besser umgehen zu können.
Im September 1991
legte die Weltbank ihr bis heute gültiges Vorgehen fest, und
zwar in der "Operational Directive 4.20" über indigene
Völker. Erklärtes Ziel dieser Politik
ist
a) sicherzustellen,
daß indigene Völker von Entwicklungsprojekten
profitieren,
b) negative Folgen
von Weltbank geförderten Aktivitäten für indigene
Völker zu vermeiden oder zu mildern.
Mit dem ersten Ziel
anerkennt die Weltbank das Recht indigener Völker, einen
Nutzen aus dem Entwicklungsprozeß zu ziehen oder selbst
daran teilzuhaben. Um ihre Anliegen in die Bank-Projekte
einzubeziehen, nennt "OD 4.20" bestimmte Vorgehensweisen. Es
sollen jeweils spezielle Entwicklungspläne erstellt werden
(Indigenous Peoples Development Plans, IPDP): Wie nur für
Indigenen reservierte Investitionen, die Aufwendung
zusätzlicher Mittel für Gesundheitsprogramme, für
Infrastruktur- und Bildungsmaßnahmen sowie zur Sicherung
ihres Zugangs zu natürlichen Ressourcen.
Mit dem zweiten Ziel
nimmt die Weltbank das Recht Indigener auf ihre natürlichen
und ökonomischen Ressourcen wahr. Durch bestimmte
Mechanismen sollen die Indigenen an allen sie betreffenden
Entwürfen und Entscheidungen - auch bei den
Hauptinvestitionen - beteiligt werden. "OD 4.20" sieht
Möglichkeiten vor, wie sich Projekte stoppen oder
hinausschieben lassen, wenn negative Auswirkungen unabwendbar
sein sollten oder der Kreditnehmer "noch keine hinreichenden
Milderungspläne" ausgearbeitet hat.
Das Diktat von
Kosten und Nutzen
Die Frage, ob
indigene Völker zu Projekten, die ihr Land, ihre Kultur und
ihre Lebensweise beeinflussen, auch "nein" sagen können, ist
entscheidend. Trotz der grundsätzlichen Beschränkheit
der Weltbank-Politik ist die Richtlinie "OD 4.20" ein wertvolles
Instrument für indigene Völker, die nicht Opfer von
Umtrieben der Weltbank werden möchten. 1994 hat die Weltbank
eine relativ unabhängige Beschwerdeinstanz eingerichtet, das
sogenannte "Inspection Panel". In 3 von 5 Fällen, in denen
Einspruch gegen ein Projekt eingelegt wurde, hat diese Abteilung
entschieden, daß "OD 4.20" von den
Entscheidungsträgern der Bank verletzt oder nicht richtig
angewandt worden sei.
Viele Bankangestellte
sind mit den Kriterien von "OD 4.20" nicht vertraut oder sie
lehnen es einfach ab, die Anweisung zu befolgen. Das geschieht
vor allem im Falle von Asien und Afrika. Die Anwendung der
Richtlinie hängt letztlich von wenigen Sachbearbeitern in
der Umweltabteilung oder in regionalen Büros ab. Die
gegenwärtige Politik der Weltbank scheint am ehesten auf
Projekte mit geographisch begrenzten Auswirkungen zugeschnitten,
wie z. B. Staudämme und Straßen.
Oft werden die
Kriterien der Weltbank erst dann bedacht, wenn starker Druck von
Außen auf geneigte Bankinsider stößt.
Gegenwärtig wird "0.D 4.20" von der Weltbank
überarbeitet. Indigene Völker fordern, daß sie
von der Bank förmlich befragt werden, bevor diese einen
Entwurf festschreibt.
Aus: pogrom
(187/96), Zeitschrift für bedrohte Völker, von Cindy
Buhl vom "Bank Information Center - Indigenous Peoples Program"
in Washington
 Lieber
ertrinken als weggehen
Lieber
ertrinken als weggehen
Ein Brief gegen
die Flutung des Sardar-Sarovar-Staubeckens
In einem offenen
Brief an den Ministerpräsidenten von Madhya Pradesh hat der
Adivasi Bava Mahalia vor den Staudamm-Projekten gewarnt. Die
Positon der Adivasi-Dörfer: Lieber in den Fluten untergehen,
als umgesiedelt werden.
"Wir leben an den
Ufern der großen Narmada. In diesem Jahr wird unser Dorf
Jalsindhi als erstes Dorf in Madhya Pradesh infolge des Sardar
Sarovar Staudamms überflutet. Seit langem wissen Sie,
daß im Dorf Manibeh in Maharashtra und im Dorf Vadgam in
Gujarat die Menschen dazu bereit sind, sich ertränken zu
lassen. Auch wir sind von der Überflutung bedroht, und
deshalb bereit, unser Leben zu geben.
Sie und alle in den
Städten glauben, daß wir Bewohner der Berge arm und
rückständig sind. Geht in die Ebenen von Gujarat.
Für Euch Bürokraten und Stadtleute sieht unser Land
bergig und unwirtlich aus, aber wir sind damit zufrieden, hier am
Ufer der Narmada zu leben mit unseren Feldern und Wäldern.
Wir leben seit Generationen hier. Wir sind nicht arm. Wir haben
die Häuser selbst gebaut. Wir sind Bauern. Unsere
Landwirtschaft entwickelt sich gut. Wir verdienen unseren
Lebensunterhalt, indem wir den Boden bestellen. Selbst wenn wir
nur das Regenwasser verwenden, so können wir doch von dem
leben, was wir selbst erzeugen.
Wir verdingen
uns nie als Tagelöhner
Wenn wir Vieh
verkaufen, die Milch oder Milchprodukte, dann verdient jeder
Haushalt drei- bis viertausend Rupees im Jahr. Wir Leute vom
Flußufer verdingen uns niemals als Tagelöhner. Seit
Generationen leben wir im Wald. Er ist unser Geldverleiher und
unsere Bank. Wir selbst essen auch Blätter aus dem Wald. In
Hungerzeiten können wir von Wurzeln und Knospen
überleben.
Wir leben im
Schoß des Waldes
Die Narmada
beglückt alle, die in ihrer Senke leben. Sie enthält
vielerlei Fische. Wir essen oft Fisch. Er ist unsere
Essensreserve. Der Fluß bringt uns Schlamm, der sich an den
Ufern absetzt, sodaß wir im Winter Mais anbauen können
und auch viele Arten von Melonen. Unsere Kinder spielen am Ufer,
schwimmen und baden Unser Vieh trinkt daraus das ganze Jahr, denn
der große Fluß trocknet niemals aus. In der
Flußsenke führen wir ein zufriedenes
Leben.
Wir leben mit unserem
Klan, mit unserer Verwandtschaft und Nachbarschaft zusammen. Wir
alle tun unsere Arbeitskraft zusammen und bauen ein Haus an einem
einzigen Tag, jäten unsere Felder und verrichten alle
anderen Arbeiten gemeinsam.
Im Dorf sind wir
alle gleich
Wir sind in diesem
Dorf geboren. Unsere Nabelschnüre sind hier begraben. Das
ist, als wären wir aus dieser Erde geboren. Alle unsere
Dorfgottheiten sind hier, und auch die Gedenksteine für
unsere Vorfahren. Wenn wir all dies zurücklassen, woher
sollen wir dann neue Götter bekommen? Wir haben dieses Land
nicht gekauft. Unsere Vorfahren haben es vielmehr gerodet und
sich hier niedergelassen.
Wir haben gegen die
Vertreibung gekämpft. Wir haben verstanden, daß Sie
die Sache entscheiden werden, wie Sie es für richtig halten.
Da Sie der neue Ministerpräsident sind, haben wir lhnen die
ganze Angelegenheit vorgetragen. Aber auch wir haben eine
Entscheidung getroffen. Zum ersten Mal ist in Madhya Pradesh Land
überflutet worden, unser Dorf wird ertrinken. Wir alle
werden in Jalsindhi ertrinken. Wir werden ertrinken, aber nicht
gehen.
Aus: pogrom
(181/95), Zeitschrift für bedrohte
Völker
 Adivasi
gegen den Staudamm
Adivasi
gegen den Staudamm
Narmada
-Widerstand erfolgreich
Mit Singen, Tanzen
und Jubel begrüßten die Bewohner und Bewohnerinnen des
Narmada-Tals die Bekanntgabe der indischen Regierung, auf weitere
Kreditleistungen der Weltbank für den umstrittenen
Sardar-Sarovar-Damm zu verzichten. Einen Tag vor Ablauf der
Frist, welche die Weltbank-Direktoren im Oktober 1992 gesetzt
hatten, um Nachbesserungen in den Projektbereichen Umsiedlung und
Umweltschutz vorzunehmen, warf die indische Regierung das
Handtuch.
Die Menschen im
Narmada-Tal feiern den Rückzug der indischen Regierung als
ihren Sieg. Zu Recht. Seit sieben Jahren kämpfen sie gegen
den Bau des Staudamms, der zusammen mit dem geplanten Kanalsystem
240.000 Menschen aus ihrer Heimat vertreiben wird. Etwa die
Hälfte von ihnen sind Adivasi (Ureinwohner). Die traurigen
Konsequenzen der Vertreibung von Adivasi sind aus anderen
Staudammprojekten hinreichend bekannt. Auf den Verlust der
Lebensgrundlagen folgen kultureller Zerfall und Verelendung.
Selbst wenn es den Verantwortlichen für das Narmada-Projekt
gelänge, genügend Ackerland für die Umsiedler zu
finden. hätte die Vertreibung katastrophale Folgen für
die Lebensweise der Adivasi. Das wird deutlich, wenn man sich die
bereits bestehenden Umsiedlungsorte ansicht. Dort warten viele
Menschen schon seit Jahren darauf, daß man ihnen das
versprochene Land zuteilt.
In der Siedlung Suka,
die ausländischen Besuchern als gelungenes Beispiel für
das Umsiedlungsprogramm vorgeführt wird, haben die beiden
Handpumpen schon ihren Dienst quittiert, so daß als einzige
Wasserquelle ein Brunnen zur Verfügung steht. Das ist
bitter, wenn man Vieh zu versorgen hat, für das jeder Eimer
Wasser mühsam mit einer Winde aus der Tiefe geholt werden
muß. Die Menschen beklagen sich, daß sie schlechtes
oder noch gar kein Land erhalten haben. Wovon sollen sie leben?
Sie müssen als Tagelöhner auf den Feldern anderer
Bauern arbeiten.
Das Umsiedlungsdorf
Suka besteht aus einer Ansammlung von relativ dicht beieinander
liegenden Häusern. Das umgebende Land ist nicht besonders
fruchtbar und die meisten der bislang zugewiesenen
Ackerflächen liegen weit außerhalb des Dorfes. Noch
entscheidender jedoch ist, daß es weit und breit kaum
Bäume gibt. So sind sie gezwungen, ihr als "Notgroschen"
gehaltenes Vieh zu verkaufen; später werden sie sich
verschulden müssen, um die Zeit vor der nächsten Ernte
zu überleben. Die zwangsweise Umstellung ihrer bisherigen
Lebensweise zwingt sie, als Lohnabhängige Geld zu
verdienen.
Der Vergleich macht
deutlich, daß die Umsiedlungen einen Zweck verfolgen: Die
Adivasi sollen modernisiert "und aus der Steinzeit" in das
Zeitalter der Moderne katapultiert werden. Dazu gehört,
daß man ihre traditionelle Wohn- und Wirtschaftsform
zerstört und sie zwingt, eine "moderne Lebensführung"
zu übernehmen.
Während ihrer
49. Sitzungsperiode 1993 hat die UN-Menschenrechtskommission in
Genf eine Resolution verabschiedet, die weitreichende
Konsequenzen für große Entwicklungsprojekte wie den
Narmada-Staudamm beinhaltet. Die Kommission bezeichnet darin die
Zwangsvertreibung von Menschen als einen groben Verstoß
gegen die Menschenrechte.
Schon mehrmals
mußten die Bauarbeiten am Narmada-Projekt wegen Geldmangels
eingestellt werden. Allein 1992 zahlte die staatliche
Staudamm-Gesellschaft Narmada Nigam ihren Auftragsfirmen deshalb
18 Millionen US-Dollar Konventionalstrafe. Der Versuch der
Narmada Nigam, 500 Millionen US-Dollar auf dem privaten indischen
Kapitalmarkt - insbesondere von reichen Auslandsindern -
aufzunehmen, ist bisher gescheitert: Gerade mal 17 Millionen
US-Dollar wurden seit 1988 für das Projekt gezeichnet. Schon
fast makaber mutet das Verfahren an, mit dem die Regierung
Gujarats zu Anfang diesen Jahres Geld in die Kassen der Nigam
umleitete. Die Opfer der religiös verbrämten Unruhen,
die im Dezember 1992 weite Teile Indiens erfaßten,
erhielten nur 40% der von der Zentralregierung auszahlten
Hilfsgelder. Ob sie wollten oder nicht, in Gujarat mußten
die Opfer 60% der Hilfe in Form von Narmada-Aktien mit einer
Laufzeit von 20 Jahren akzeptieren.
Als potentielle
Geldgeber für den Weiterbau des Staudamms sind jetzt
Länder wie Korea, Malaysia und Taiwan im Gespräch. Aber
auch die Weltbank könnte über einen Sektorkredit
indirekt Sardar-Sarovar weiter finanzieren. Auch deshalb
muß die internationale Unterstützung für die
Menschen im Narmada-Tal weitergehen.
Aus: pogrom
(171/93), Zeitschrift für bedrohte Völker von Bruni
Weißen, Aktionsgemeinschaft Solidarische
Welt
 Neue
Hoffnung auf Selbstbestimmung
Neue
Hoffnung auf Selbstbestimmung
Für eine
indigene Zivilgesellschaft
"Ein Licht am Ende
des Tunnels" lobte Ram Dayal Munda, Präsident des Indigenen
Dachverbandes Indian Confederation of Indigenous and Tribal
Peoples (ICITP), ein neues Gesetz zur Selbstverwaltung in Indiens
Stammesgebieten. Die lang ersehnte Autonomie ist in greifbare
Nähe gerückt. Die Regierung ist bereit, den
Dorfräten weitreichende Befugnisse zu übertragen. Viele
von uns können kaum glauben, daß solch ein Gesetz das
Parlament passieren konnte. Optimistisch bewertet die ICITP das
neue Gesetz.
Mehr Dynamik wird die
ICITP, dem sich mittlerweile 150 Organisationen angeschlossen
haben, in Zukunft dringend benötigen. Das im Dezember 1996
vom Nationalparlament in Neu Dehli verabschiedete neue
Selbstverwaltungsrecht (Panchayats Extension to the Scheduld
Areas Act 1996) ermächtigt die traditionellen Dorfräte
zur Kontrolle und Mitsprache in der lokalen Verwaltung sowie bei
der Nutzung der Wälder und anderer Naturressourcen. In
Zukunft können Adivasi-Gemeinschaften eigene Schulen und
Hospitäler betreiben, die Löhne fehlbarer Polizisten
oder Lehrer zurückhalten sowie bei
Entwicklungsmaßnahmen ein gewichtiges Wort
mitreden.
"Sie müssen
lernen, mit Macht und Geld umzugehen," kommentiert Ram Dayal
Munda, "gewiss keine Stärke der Adivasi. Wie können wir
uns diese Qualifikationen aneignen? Kann ein allgemein
respektierter traditioneller Führer Chef des Dorfrates
werden, auch wenn er weder lesen noch schreiben kann? Wie
können wir Frauen besser an Entscheidungsprozessen
beteiligen? Der Aufbau einer funktionierenden Selbstverwaltung
muß mit einer Modernisierung unserer ganzen Gesellschaft
einhergehen".
Eine wichtige Rolle
könnte der ICITP bei der Umsetzung der neuen Bestimmungen
des Nationalparlamentes spielen. Zunächst gilt es, Druck auf
die Regierungen der Unionsstaaten auszuüben, die die
Vorgaben in Verordnungen ummünzen werden. Es wird also noch
Jahre dauern, bis das geflügelte Wort lhamara gaon men
hamara raj (in unserem Dorf bestimmen wir selbst) Wirklichkeit
werden kann.
Aus: pogrom
(195/196-1997), Zeitschrift für bedrohte Völker von
Rainer Hörig
 Menschenrechte - Handeln tut
not
Gesellschaft
für bedrohte Völker
Menschenrechte - Handeln tut
not
Gesellschaft
für bedrohte Völker
Informieren, sich
engagieren, das GfbV-Büro hilft Ihnen gern dabei. Wir sind
Teil eines Netzwerkes mit Sektionen und Büros in
Deutschland, in der Schweiz, in Österreich und Luxemburg.
Aus der 1968 gegründeten "Biafra-Hilfe" entstand die GfbV
als Menschenrechtsorganisation für verfolgte und
unterdrückte ethnische und religiöse Minderheiten,
Nationalitäten und Ureinwohnergemeinschaften. Wir
informieren über deren Lage, ungeschminkt und auch
parteiisch. Wir versuchen mit Öffentlichkeitsarbeit Druck
auf Regierungen auszuüben.
Seit 1993 hat die
GfbV einen beratenden Status beim Wirtschafts- und Sozialbeirat
der Ver-einten Nationen und ist von der UNO als
Nicht-Regierungsorganisation (NGO) anerkannt. Die 1992 in
Südtirol gegründete Sektion setzt auf Bildungsarbeit
und kulturellen Austausch, Menschenrechtsarbeit auf politischer
Ebene und unterstützt
Solidaritätsprojekte.
Büro der GfbV:
Lauben 49, 39100 Bozen (Tel. + Fax 0471/9722 40)
E-mail: info@gfbv.it - http://www.gfbv.de und https://www.gfbv.it.
Bibliothek
Kulturen der Welt
In unserem Büro
gibt es noch mehr, die Bibliothek Kulturen der Welt. Zum Thema
Dritte Welt, Völker und Menschen des Südens, Menschen
auf der Flucht stehen mehr als 1.000 Dokumentar- und Spielfilme
zur Auswahl, weitere 4.000 deutsche und italienische Bücher,
Fachzeitschriften und Broschüren. Ein Archiv über
bedrohte Völker und ethnische Minderheiten ergänzt das
Angebot. Die Bibliothek arbeitet eng mit der GfbV, mit Amnesty
International und vielen Eine-Welt-Gruppen zusammen: Zur
Bibliothek gehört auch die Nicaragua-Solidaritätsgruppe
"Quincho Barrilete".
E-Mail: mail@bibmondo.it - http://www.bibmondo.it.
Amnesty
International (A.I.) ist als Gefangenenhilfsorganisation 1961
gegründet worden. Die weltweit größte
Menschenrechtsorganisation engagierte sich für die Befreiung
der wegen Meinungsäußerung Inhaftierten. AI ist in 150
Ländern aktiv. In Südtirol gibt es in Bozen, Eppan,
Meran, Schlanders und im Gadertal AI-Gruppen.
Die Kontaktadresse in
Bozen: Bibliothek Kulturen der Welt, Lauben 49, 39100 Bozen (Tel.
+ Fax.
0471/972240) -
E-Mail: info@amnesty.it - http://www.amnesty.it
Ecolnet ist
ein internationaler Verein von Gewerkschaftern,
Umweltschützern und Wissenschaftlern. Das Anliegen des
Vereins ist eine neue "Ethik der Solidarität" zwischen Nord
und Süd. Ecolnet entwickelt Modelle für eine sozial-
und umweltgerechte Wirtschaft.
Sitz des Ecolnet:
Südtirolstraße 19, 39100 Bozen, (Tel. 0471/973005, Fax
0471/973172) - E-Mail: ecolnet@ines.org - http://www.ines.org/ecolnet
FIAN - Food
First Information & Action Network - Engagiert sich seit 1986
als UN-anerkannte
NGO für das
Recht auf Nahrung und unterstützt Kleinbauern, indigene
Völker, Fischer und Lohnabhängige. FIAN hat in 15
europäischen, asiatischen und afrikanischen Staaten
nationale Sektionen. FIAN hat seine Zentrale im bundesdeutschen
Herne.
Kontaktadresse in
Südtirol: FIAN-Koordinationsstelle, Georg Siller,
Stenizerweg 2, 39022 Algund, (Tel. 0473/221738) - E-Mail: fian@herne.netsurf.de -
http://www.fian.org
OEW - Die
Organisation für Eine solidarische Welt ist die
größte entwicklungspolitische Organisation
Südtirols. Die OEW ist das Informationszentrum für 40
Eine-Welt-Gruppen und sechs Weltläden. Neben der
Informations- und Bildungsarbeit, mit vielen öffentlichen
Aktionen und Schulinitiativen, fördert die OEW
Selbsthilfeprojekte (in Zusammenarbeit mit Genossenschaften,
Dorfgemeinschaften und Missionaren) im Süden der
Erde.
Sitz der OEW: Kleine
Lauben 7, 39042 Brixen - E-mail: info@oew.org - http://www.oew.org
Die
Europäische Akademie Bozen der Landesregierung betreibt
seit 1993 angewandte Forschung und Weiterbildung auch im Bereich
"Ethnische Minderheiten und regionale Autonomien". Im Auftrag der
Landesregierung hat die Akademie das "Paket für Europa"
ausgearbeitet. Die Anschrift der Abteilung "Ethnische
Minderheiten und regionale Autonomien" der Akademie:
Weggensteinstr. 12/a, 39100 Bozen (Tel. 0471/306090, Fax
0471/306099) - E-Mail: info2@eurac.edu - http://www.eurac.edu/fb2
Die
Landesregierung hat in ihrem Amt für
Kabinettsangelegenheiten das Referat
Entwicklungszusammenarbeit eingerichtet. Dieses Referat
verwaltet die Finanzen für Hilfsprojekte. Mehr als 50
Organisationen haben mit der Landesregierung eine Vereinbarung im
Bereich Entwicklungszusammenarbeit getroffen. Im Referat sind
auch weitere Informationen über die entwicklungspolitischen
Organisationen erhältlich:
Autonome Provinz
Bozen/Südtirol - Amt für
Kabinettsangelegenheiten
Referat
Entwicklungszusammenarbeit: Crispistr. 3, 39100 Bozen, (Tel.
0471/992131, Fax:0471/992245) - E-Mail: kabinett@provinz.bz.it
Eine
Publikation der Gesellschaft für bedrohte Völker.
Weiterverbreitung bei Nennung der Quelle
erwünscht
Una pubblicazione dell'Associazione per i popoli
minacciati. Si prega di citare la fonte @@@ WebDesign: M.
di Vieste