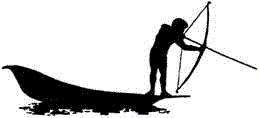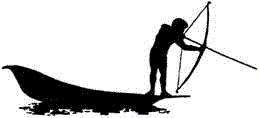 |
Die Wächter der
Wälder
"Unsere Zukunft ist eure Zukunft"
Eine Unterrichtseinheit
über indigene Völker, Klimabündnis und wir, Mai
2000
Gesellschaft für
bedrohte Völker - Südtirol
Landesamt für Luft und Lärm, Autonome Provinz
Bozen
Pädagogisches Institut Bozen
|
INHALT
 Land unter
Wasser
Land unter
Wasser
Die Vinschger
Erfahrungen mit dem "nationalen Interesse"
Der Malser
Bürgermeister, Josef Noggler, Sprecher des Vinschgauer
Stromkonsortiums, wird vehement, wenn es um die Wasserrechte und
um die Stromgewinnung geht. Die Vinschger haben eifersüchtig
ihr verbrieftes Recht auf Wasser verteidigt - das Wasser in
diesem trockenen Landesteil garantiert das wirtschaftliche
Überleben. Im oberen Vinschgau wollen deshalb die Gemeinden
die Kontrolle über das Wasser behalten, auch gegen die
Pläne der Landesregierung, über die Energiegesellschaft
SEL die Strom-Konzerne Enel und Edison zu
beerben.
Noggler
begründet das Vinschgauer Mißtrauen mit den gemachten
Erfahrungen - vor einem halben Jahrhundert wurden 500 Hektar Land
samt dem Gauner Dorf von den gestauten Fluten überschwemmt.
Der Montecatini-Konzern ließ das Land unter Wasser setzen.
Ermöglicht hat dies ein königliches Dekret 1943, laut
dem der Bau des Wasserkraftwerkes "der wirtschaftlichen
Selbständigkeit und der nationalen Verteidigung Italiens
dienen soll", erinnert Johann Prenner in seiner Arbeit
"Erinnerungen an Alt-Reschen". Im Vorwort schreibt Johann
Patscheider, Fraktionsvorsteher von Reschen:" Es ist schon bald
ein halbes Jahrhundert her, als im oberen Vinschgau durch den Bau
eines Stausees die Heimat vieler Menschen und mit ihr wertvolles
Kulturgut für immer verloren ging. (...) Heute gibt es immer
weniger Zeugen dieser Zeit. Es besteht die Gefahr, daß
dieses schreckliche Ereignis bald ad acta gelegt wird. (...)
Besonders schmerzhafte Erinnerungen mag dieses Werk bei all jenen
wecken, die ihr Hab und Gut verloren haben und in einer fremden
Welt eine neue Heimat suchen mußten".
Der Grauner Kirchtum,
gebaut im 14. Jahrhundert, ist das bauliche Überbleibsel von
Reschen. Die Häuser des alten Dorfes wurden gesprengt, bevor
die gesamte Tahlsohle zwischen St. Valentin auf der Haide bis
nach Reschen unter Wasser gesetzt wurde. Mehr als 70 Familien -
die im Wasser alles verloren hatten - mußten Graun
verlassen, 16 Familien Reschen. "Umgesiedelt" wurden auch die
Begrabenen des Grauner Friedhofs. Jene Grauner, die bleiben
konnten, fanden kurzfristig am Talanfang von Langtaufers in
Baracken Unterkunft. Die von den Fluten verschonten Bürger
von Reschen gründeten das neue Reschen in der "Kloan-Tauf"
im "Bsäimta".
1939 wollten zwar ein
Großteil der Grauner und der Bewohner von Reschen
freiwillig durch ihre "Option" für NS-Deutschland abwandern,
zehn Jahre später vertrieben die Fluten die Dörfler.
Verbittert schreibt Prenn in seinen "Erinnerungen an
Alt-Reschen": "Diejenigen Bewohner beider Dörfer, die
abwandern mußten, weil sie alles verloren hatten, sahen
einer düsteren Zukunft entgegen, vor allem deshalb, weil die
Ablösung der Liegenschaften und die Entschädigung in
Form eines Neuankaufs irgendwo und irgendwann bei weitem noch
nicht abgeschlossen war und nur schleppend vorankam. Alles in
allem, die Ablöse und Durchführung der
Entschädigungen konnte in ihrer Abwicklung mit dem Steigen
des Wassers keineswegs Schritt halten".
Die hartnäckige
Haltung heute der Vinschger im Kampf um Wasserrechte und die
Stromautonomie ist angesichts dieser Geschichte
verständlich. Die Gemeinden wollen ihren Stausee und die
Stromproduktion kontrollieren. Sie fürchten sich davor,
übergangen zu werden. Ähnliche Motive bewegten auch die
Grundbesitzer auf der Malser Haide, die sich energisch gegen ein
Wasserkraftwerk des Bonifizierungskonsoritums Vinschgau zur Wehr
setzen.
Die Geschichte des
Stausees am Reschen beginnt mit der italienischen Annexion
Südtirols. "Für die Annexion hatte neben
strategisch-militärischen Gründen auch die Ausbeutung
der wirtschaftlichen Resourcen - Holz und Wasserkraft - eine
Rolle gespielt," heißt es im Kapitel "Entheimatung" (von O.
Kiem, H. Mock & A. Zendron) im Ausstellungskatalog "Option,
Heimat, Opzioni" des Tiroler Geschichtsvereins. Bis Ende der 30er
Jahre wurden Kraftwerke in Marling, Brixen, Pfitsch, Gröden,
Waidbruck und Kardaun gebaut. Das Kardauner Kraftwerk war 1929
das größte Europas.
Schon 1920
bemühten sich Konzerne um entsprechende Konzessionen aus
Rom, um den Reschen- und den Graunersee zu stauen. Geplant war
damals eine fünf Meter hohe Staumauer. Aber erst 1939
schaffte es Montecatini. Auf der Gemeindetafel von Graun
informierte Montecatini die Bevölkerung über die
Pläne - der See sollte auf 22 Meter gestaut werden. Da die
Bürger von der italienischen Projektankündigung keine
Notiz nahmen "und nachdem nach acht Tagen die gesetzlich
vorgeschriebene Frist für einen Rekurs verstrichen war" (J.
Prenn - Erinnerungen an Alt-Reschen), machte sich Montecatini an
die Verwirklichung. 1947 zogen Arbeiter in St. Valentin auf der
Haide die Staumauer hoch, 1950 waren die Arbeiten
abgeschlossen.
Die Proteste der
Grauner und deren Kundgebungen fanden bei Montecatini kein
Gehör, die Eingabe beim zuständigen Ministerium in Rom
genausowenig. Der Grauner Pfarrer Alfred Rieper versuchte den
Rest zu retten - in der mit einer Staumauer abgeschlossenen
Talsohle staute sich bereits das Wasser. Pfarrer Rieper verlangte
den Bau von Häusern, drängte auf Entschädigungen,
auf eine Aussicht auf eine Alternative.
David gegen Goliath,
in diesem Fall war die Niederlage für David nicht mehr
aufzuhalten. Die Industrien in Norditalien drängten auf
Strom, genauso ein Schweizer Konzern, der mit vielen Franken
Projekte von Montecatini vorfinanzierte. Johann Prenn: "Wer
sollte es da der betroffenen Bevölkerung von Graun und
Reschen verargen, wenn ihr die volkswirtschaftlichen
Notwendigkeiten kein genügender Trost waren, um sich
über das eigene Unglück mit Gelassenheit
hinwegzusetzen? Darum kann man bestimmt nicht erwarten, daß
die Menschen damals aus Begeisterung über den Bau eines
solches Werkes, das angeblich für das Allgemeinwohl, vor
allem aber für das Gedeihen kapitalistischer Gesellschaften
Italiens und der Schweiz entstehen soll, ihre sieben Sachen
packen und (...) auswandern sollten, da sie ja aus dem Bau dieses
Werkes keinerlei Nutzen zu erwarten hatten".
Die, die auswandern
mußten, fanden eine neue Heimat irgendwo in Südtirol,
auch in Nordtirol und im Trentino. Die, die bleiben konnten,
leben inzwischen mit dem See und hoffen, irgendwann den See
zurückzubekommen. Johann Prenn: "Die Jahre zogen ins Land
und die Wochen in Sachen Seestauung begannen sich zu
glätten. Die Menschen haben sich allmählich an den
Zustand gewöhnt. Die Zeit vermag ja Wunden zu heilen. Man
kann zwar vergessen, aber damit sind die nun einmal geschaffenen
Tatsachen auch nicht aus der Welt geschaffen".
Von: Wolfgang
Mayr; aus: "Erinnerungen an Alt-Reschen" von Johann
Prenn
 Dighe e
genocidio
Dighe e
genocidio
Il caso Vajont:
una calamità artificiale
DIGA FUNESTA,
PER NEGLIGENZA E SETE
D’ORO
ALTRUI
PERSI LA VITA, CHE
INSEPOLTA RESTA
Lapide presso la
diga in memoria di uno dei dispersi del
Vajont
Una valle
alpina
Da occhi diversi la
stessa realtà può essere osservata con intenzioni
diverse. La valle del Vajont, come si presentava intorno al 1950,
ne costituisce un esempio.
Agli occhi dei
dirigenti e dei tecnici della potente S.A.D.E., società
monopolista dell’elettricità nell’Italia
nord-orientale, essa costituiva un colossale affare. Si trattava
di una stretta, ripida vallata delle Prealpi Carniche, ricca di
acque e tributaria della valle del fiume Piave, da cui la
separavano un forte dislivello ed una strettissima gola; in
posizione strategica nell’ambito del progetto, allora in
fase di realizzazione, della captazione di tutte le acque del
bacino a fini idroelettrici. La posizione ideale per realizzare
una colossale diga, fra le più grandi realizzate sino ad
allora, e per produrre un’enorme quantità di
energia.
Nulla pareva
ostacolare questo ambizioso disegno. Non la politica, favorevole
alla produzione idroelettrica, necessaria alla nascente industria
nelle zone di pianura (e del resto assai “sensibile”
alle richieste dei potenti azionisti della S.A.D.E., ex-fascisti
passati armi e bagagli al nuovo potere della Democrazia
Cristiana); non la geologia, secondo quanto andavano sostenendo i
reputati “luminari” sul libro paga della
società. L’unico, trascurabile ostacolo era
rappresentato dagli abitanti della valle che sarebbe stata
sommersa una volta costruita la diga.
Proviamo ora a
considerare gli stessi luoghi da un altro punto di vista. Erto e
Casso, due villaggi a distanza di pochi chilometri, riuniti nello
stesso Comune, entrambi arroccati sul ripido pendio a solatio: i
vicoli stretti, coi muri di sasso ed i tetti di una particolare
pietra locale, che si trova già sfaldata nella misura
giusta per sostituire le tegole: genere costoso, e quindi
“di lusso”.
Due paesi accomunati,
oltre che dalla vicinanza, anche dall’isolamento, dalle
stesse, magre risorse e dal medesimo stile di vita, grazie al
quale, a prezzo di notevoli stenti, gli abitanti potevano
sostentarsi.
Il versante destro
della vallata, magro e sassoso, benché esposto a
mezzogiorno, non permetteva certo una produzione agricola
sufficiente. Maggiori erano le possibilità offerte dal
versante sinistro, meno ripido e più fertile,
benché in ombra nei mesi invernali. La distanza ed il
dislivello da superare, tuttavia, non permettevano di recarsi
agevolmente da un lato all’altro della valle più
volte al giorno, per le operazioni necessarie
all’agricoltura ed alla cura del bestiame.
Da tempo
immemorabile, quindi, le famiglie ertocassane disponevano
generalmente di due abitazioni, costruite a prezzo di grandi
sacrifici: una invernale, negli abitati sul versante soleggiato,
ed una estiva nel lato più fertile della valle, ove
l’intera famiglia si trasferiva per vari mesi con i propri
animali. Non si trattava di un lusso, o di una forma di
“villeggiatura”, ma di una necessità,
essenziale per la sopravvivenza in quei luoghi.
Ma neanche questo
bastava: per centinaia e centinaia di ertocassani, uomini e
donne, il prodotto dei campi e dell’allevamento non bastava
che per pochi mesi. Per integrare questo magro reddito, non
restava che la via, praticata da secoli, dell’emigrazione.
La specialità degli ertocassani, sebbene vi fossero anche
emigranti di altro mestiere, era quella del commercio ambulante.
Mestoli, piatti, ed altri utensili in legno, e le tipiche scarpe
di pezza, prodotti in casa con le povere risorse locali,
costituivano i generi di esportazione, venduti al minuto nelle
regioni vicine, in tutto il Nord Italia ed anche
all’estero, da uomini e soprattutto da donne che, a prezzo
di incredibili stenti, si portavano a venderli, generalmente a
piedi, di mercato in mercato e di paese in paese; e ciò
per generazioni. Tanto più attaccati al proprio piccolo
mondo quanto più lontano erano costretti ad emigrare, i
valligiani del Vajont portavano per i luoghi natii una fortissima
affezione.
Ciò che
divideva Ertani e Cassani, oltre al “normale” spirito
campanilistico caratteristico di tutte le zone montane, erano la
lingua e la storia. Gli Ertani parlavano un linguaggio proprio,
ricco di suoni e di vocaboli peculiari, che ha suscitato un
notevole interesse tra gli studiosi di linguistica, sollevando
interrogativi storici e lunghe discussioni per la somiglianza col
Ladino delle Dolomiti, piuttosto che con il Ladino del Friuli. A
Casso, invece, l’ultimo paese del Friuli prima del confine
con il Veneto, si parlava un dialetto veneto alpino. Questo fatto
pareva confermare l’idea degli Ertani di essere i primi
abitanti della valle: primato non solo di onore, che in altri
tempi aveva scatenato lunghissime liti, relative a concretissimi
e vitali interessi.
Oggetto del
contendere era la “comugna”: la terra collettiva
inalienabile, aperta al pascolo ed al legnatico, che qui, come in
genere nelle zone alpine, costituiva gran parte del territorio.
Fin dai tempi della Repubblica di Venezia le due comunità
si erano scontrate per il possesso di questa preziosa risorsa. Il
fondo dei “Proveditori sopra beni communali” presso
l’Archivio di Stato di Venezia conserva tuttora, come chi
scrive ha potuto verificare, un’ingente documentazione su
quelle lunghissime liti. Base della sussistenza economica, e
luogo d’identificazione collettiva, le terre comuni di Erto
e Casso rimasero contese per secoli.
Come si
costruisce una catastrofe
E proprio dalle
“comugne” cominciò la rovina. Con un decreto
(non esente da dubbi sotto il profilo giuridico), il Commissario
agli usi civici di Venezia, il magistrato cui è affidata
la tutela di simili terre, protette da un particolare vincolo di
inalienabilità anche dal vigente diritto italiano,
autorizzava la cessione di 88 ettari delle “comugne”
di Casso alla società S.A.D.E.
Si trattava
dell’area destinata alla costruzione della diga, e del
primo nucleo di terre destinate alla sommersione. Il decreto fu
poi confermato, in data 2 febbraio 1950,
dall’autorizzazione del Ministro per l’Agricoltura,
il futuro presidente della Repubblica Segni.
La storia degli anni
seguenti è una storia di violenza e di soprusi, di
espropri di case e di terre a prezzi ridicoli, di occupazioni di
fatto realizzate dalla S.A.D.E. senza reazioni delle
autorità alle giuste proteste degli abitanti; di
autorità che “si fidano” delle relazioni di
famosi geologi (sul libro paga della S.A.D.E.: la scienza
raramente è neutrale), piuttosto che delle preoccupazioni
degli abitanti, convinti, e per la conoscenza dei luoghi, e per
la memoria storica di grandi frane avvenute nei secoli passati,
che l’immensa pressione delle acque del costruendo bacino
avrebbe potuto rendere instabili i fianchi della vallata.
Indifferente alle proteste, la S.A.D.E. continuò
l’opera, aumentando addirittura l’altezza della diga
dai progettati 200 ad oltre 260 metri, moltiplicando così
la capienza del bacino e la pressione dell’acqua sui
fianchi delle montagne. Le relazioni preoccupate di altri geologi
che avevano segnalato l’instabilità dei versanti
della valle, commissionate anch’esse dalla S.A.D.E., furono
accuratamente celate.
Per
“controllare” ed eventualmente reprimere le proteste
degli ertocassani, che si erano organizzati in un Comitato per
difendere la propria valle ed il proprio futuro, fu stabilita ad
Erto una stazione dei Carabinieri.
Per comprendere
meglio ciò che accadde va considerato che, oltre agli
ottimi rapporti con politici ed amministratori, la S.A.D.E.
poteva anche vantare il controllo del “Gazzettino”,
il giornale più letto in Veneto e Friuli. In tutta la
vicenda la stampa, come del resto la politica e
l’amministrazione, non svolse certo un ruolo imparziale.
Minimizzando i rischi dell’opera, magnificando gli aspetti
ingegneristici ed il “progresso” che la diga avrebbe
portato, diffamando sistematicamente chi si opponeva con tutte le
sue forze alla realizzazione del progetto, anche i mezzi di
comunicazione contribuirono alla “costruzione della
catastrofe”.
Unica eccezione, il
quotidiano comunista “Unità”, che fin
dall’inizio prese le parti degli ertocassani. Non senza
rischi: la giornalista Tina Merlin, che dalle colonne di quel
giornale aveva denunciato il rischio di una colossale frana dai
fianchi del monte Toch, sulla sinistra della valle, fu denunciata
per “procurato allarme a mezzo stampa”, e solo dopo
un lungo processo poté provare la propria
“innocenza”!
I segni premonitori
della catastrofe furono volutamente ignorati. Dai fianchi del
monte Toch, al momento delle prime prove d’invaso, si
staccò una notevole frana. I progettisti, in previsione di
un’ulteriore, grande smottamento costruirono un canale per
scolmare le acque del lago, che la frana stessa avrebbe potuto
dividere in due. Non passò per la testa a nessuno (almeno
a nessuno dei tecnici) che una frana di tali dimensioni avrebbe
potuto sollevare un’onda di piena nel lago, tale da mettere
in pericolo non solo il centro di Erto, ma anche i paesi a valle
della diga. I lavori nella valle del Vajont proseguirono senza
soste, anche quando, a seguito della nazionalizzazione degli
impianti idroelettrici, impianti e personale passarono dalla
S.A.D.E. al nuovo ente E.N.E.L.
Con ciò lo
Stato italiano entrò a pieno titolo fra i responsabili
della sciagura: non solo, come prima, per la compiacente mancata
sorveglianza; ma come responsabile diretto della
catastrofe.
I boati e le scosse,
avvertiti dai valligiani sempre più frequentemente, furono
attribuiti dalle autorità a “fenomeni di origine
sismica”.
La notte del 9
ottobre 1963, prima ancora che fossero ultimate le prove
d’invaso, il monte Toch, minato dalle infiltrazioni delle
acque del bacino, franò nel lago.
In pochi istanti una
massa di rocce di oltre trecento milioni di metri cubi, vasta
oltre duecento ettari ed alta più di duecento metri,
scivolò per un fronte lungo chilometri sugli strati
rocciosi sottostanti, e trascinò con sé boschi,
pascoli, case, stalle, persone ed animali; dividendo in due il
lago, e seppellendo le case presso la diga con tutti i loro
abitanti.
Cacciata a forza dal
lago, l’acqua del bacino si sollevò in due mostruose
ondate. La prima inghiottì in pochi secondi la parte bassa
di Erto, le borgate di Spesse e San Martino, e numerose case
sparse, con tutti i loro abitanti.
La seconda
lambì il centro di Casso, scavalcò la diga e
precipitò, centinaia di metri più in basso, sulla
valle del Piave. In cinque minuti il florido centro di Longarone,
e le frazioni di Pirago, Codissago, Dogna e Provagna furono
sepolti da un muro d’acqua alto più di settanta
metri. In pochi istanti di quei paesi non rimase pietra su
pietra.
La diga, risparmiata
dalla frana, rimase intatta, come si può vedere
tuttora.
Le vittime della
sciagura, sommando morti e dispersi dei vari Comuni interessati
(in primo luogo Longarone, Erto e Casso, Castellavazzo), furono
più di 2.100 (le stime, in ogni caso, variano di qualche
decina: i cadaveri si trovavano dispersi da Termine di Cadore,
vari chilometri a monte di Longarone, fino al mare
Adriatico).
Dopo il
genocidio, la deportazione
Il calvario dei
sopravvissuti non finì con il disastro. La stampa si
affannò, anche se con magri risultati, ad attribuire la
catastrofe ad un “imprevedibile evento
naturale”.
Non fu dello stesso
parere la magistratura. Tuttavia il lungo processo penale ai
responsabili del disastro (svoltosi in primo grado
all’Aquila, perché si ritenne che i superstiti
potessero “turbare” il giudizio nella naturale sede
di Belluno) si concluse con una sola condanna a dieci anni, di
cui uno solo fu realmente scontato.
Occorsero lunghissimi
anni di battaglie giudiziarie perché i sopravvissuti, gli
emigranti che avevano perso tutto, ed i parenti delle vittime
ottenessero un risarcimento. Molti, esasperati dalla lunga
attesa, accettarono svantaggiose transazioni.
Mentre la
ricostruzione di Longarone (per la verità dopo
un’iniziale stagione di proteste dei sopravvissuti,
esasperati dalla lentezza degli interventi) procedette in modo
relativamente spedito (oggi Longarone è una cittadina con
grandi, forse sovradimensionate, infrastrutture; anche se quella
che la abita è in gran parte altra gente, giunta dopo la
sciagura), il destino di Ertani e Cassani, anche dopo il disastro
contro cui molti di essi avevano lottato con tutte le proprie
forze, fu assai difficile.
Ertani e Cassani
furono sgomberati a forza dalle loro case l’11 ottobre
1963, due giorni dopo la catastrofe. Le stesse autorità
che avevano ignorato i segnali di allarme prima della sciagura,
ora evacuavano la popolazione a disastro
avvenuto.
A sostenere
l’evacuazione, stranamente, le autorità comunali.
Atteggiamento sospetto, secondo molti abitanti. La S.A.D.E., ora
divenuta E.N.E.L., cercava ancora di sfruttare il bacino, a costo
di allontanare la popolazione. Alcuni abitanti tornarono
clandestinamente al paese, a recuperare i propri morti,
nonostante alle loro case, con beffarda ironia, fosse stata
“tagliata” la corrente elettrica. Il disegno del
“trasferimento”, tuttavia, andò avanti. Per
gli sfollati fu costruito un nuovo paese nella pianura friulana,
battezzato Vajont. Molti, specialmente coloro i quali avevano
perso la casa o il lavoro, accettarono di abitarvi. Un secondo
gruppo di famiglie fu stanziato nella “Nuova Erto”
presso Ponte nelle Alpi. Altri emigrarono altrove (qualcuno anche
in Provincia di Bolzano).
Sul trasferimento di
queste persone si giocarono molte speculazioni. Fra il personale
comunale vi fu chi fece incetta delle licenze commerciali dei
sinistrati, che secondo una normativa accuratamente tenuta
nascosta agli interessati, si potevano trasferire in altre
località.
I fondi per la
ricostruzione, e le provvidenze economiche per chi nel disastro
aveva perso anche il lavoro, furono così in buona parte
dirottati in una zona diversa da quella sinistrata. Il nuovo
comune di Vajont, tuttavia, fu dotato di un territorio
piccolissimo. Le fabbriche ed i posti di lavoro promessi agli
sfollati furono così installati in territorio di altre
amministrazioni, sotto il controllo altrui. Per molti abitanti di
Vajont non restò che un posto in fonderia, malsano e
malpagato.
La comunità fu
così smembrata. Un terzo gruppo decise di rimanere ad
Erto, battendosi con successo per lo svuotamento del lago. Dopo
ben dieci anni costoro ebbero riconosciuto il diritto ad
un’abitazione in zona sicura, a monte del vecchio centro
danneggiato dalle acque del bacino.
A distanza di
trentasei anni dalla frana, in una valle dalla morfologia
sconvolta, anche Erto è rinato, grazie ad un pugno di
“irriducibili” che non vollero abbandonare la propria
terra. Casso, invece, il cui centro storico fu risparmiato dalla
sciagura, è oggi un paese fantasma: quasi tutte le sue
famiglie accettarono il trasferimento.
Nel disastro i
Cassani non persero le case, ma il territorio. I loro beni
migliori, le loro terre collettive e private, erano sulle pendici
del Toch. La perdita dei beni distrusse quella
comunità.
Stefano
Barbacetto, Letteratura: Tina Merlin, Sulla pelle viva. Come si
costruisce una catastrofe: il caso Vajont, Cierre
1997
 Wer sind die
Indigenen?
Wer sind die
Indigenen?
Ureinwohner,
Eingeborene, Hüter der Erde?
Indigene
Völker haben ein Kriterienraster entwickelt - so
der,,Weltrat der indigenen Völker" (World Council of
lndigenous Peoples) -, um ihren Anspruch auf eine eigene
ldentität historisch zu untermauern. Angehörige
indigener Völker sind Menschen, die in Ländern mit
unterschiedlichen ethnischen Gruppierungen leben und als
Nachkommen der ersten Siedler gelten. Sie wurden später von
anderen unterworfen, kolonisiert und von ihren
ursprünglichen Siedlungsräumen teilweise vertrieben.
lhre Kulturen - und damit auch Formen der Selbstregierung -
wurden zerstört oder in eine gesellschaftliche Minderheiten-
oder Randposition gedrängt.
Gleichwohl weisen
indigene Völker Restbestände einer eigenen Kultur -
einschließlich Formen der politischen und sozialen
Organisation - auf, verfügen über eine eigene Sprache,
eigene Religion(en) und eigene Vorstellungen über ihre
Zukunft und Entwicklung. Das gilt z.B. für den Umgang mit
der Natur, der meist ökologisch angepaßt und schonend
ist, und der die Existenz zukünftiger Generationen nicht
gefährdet oder gar zerstört.
Indigene Völker
leben am Rande der Entscheidungsprozesse. In Brasilien
äußert sich dies etwa in den Unterschieden bei der
durchschnittlichen Lebenserwartung. Laut Statistik lebt ein
nicht-indianischer Staatsbürger Brasiliens 67 Jahre, bei
lndianern beträgt die Lebenserwartung nur 46
Jahre.
Ein weiteres
zentrales Kriterium ist schließlich die sogenannte
Selbstidentifikation: Betroffene wie etwa die Saami in Nordeuropa
entscheiden selbst, ob sie sich entsprechend den genannten
Merkmalen als ,,indigen" bezeichnen wollen oder nicht.
Völker wie die Kurden im Nahen Osten oder die Tibeter tun
dies nicht und werden daher auch nicht zu den Indigenen
gezählt.
Viele Begriffe
für indigene Völker wie Eingeborene, Urvölker,
Jäger- Sammler-Völker oder Naturvölker erfassen
zwar einen Teil dessen, was ihre ldentität ausmacht. Einige
Begriffe sind jedoch im Sprachgebrauch abwertend, historisch
vorbelastet oder nicht ausreichend. So legt die Bezeichnung
Jäger-Sammler- oder Naturvölker eine primitiv-einfache
Form der Naturverarbeitung nahe. Zum einen haben nicht alle
indigenen Völker ihren Nahrungserwerb durch solche
Tätigkeiten bestritten. Zum zweiten haben indigene
Völker ausgeklügelte Produktionssysteme, die nicht zu
unseren Vorstellungen vom einfachen Leben passen:
die,,schwimmenden Gärten" (,,Chinampas") im heutigen Mexiko,
Terrassen und Bewässerung im Hochland der Anden,
Überschwemmungsvorsorge an der Atlantikküste im
heutigen Kolumbien, eine weise abgestimmte Waldnutzung und
Sammelwirtschaft bei den Adivasi in lndien.
Aktuelle
Schätzungen gehen von 250 bis 300 Millionen Ureinwohnern
aus, die sich auf ungefähr 5000 unterschiedliche Völker
in 76 Staaten und alle Kontinente verteilen (4% der
Erdbevölkerung auf 10 bis 15% der Landfläche). Den
größten Anteil stellen die Adivasi lndiens und
indigene Völker in China mit jeweils zwischen 70 und 80
Millionen, gefolgt von den Ureinwohnern Amerikas, die knapp
über 40 Millionen zählen. Die Tuareg in den
Sahara-Staaten gehören ebenso dazu wie Pygmäen im
zentralafrikanischen Regenwald, Penan in Malaysia,
Bergvölker in Bangladesh und Burma, Ainu in Japan,
sibirische Völker in Rußland, Maori in Neuseeland,
Aborigines in Australien, Bewohner der pazifischen lnseln, lnuit
in Alaska, Kanada, Grönland und der Ex-GUS und Saami in
Nordeuropa. In den Regenwäldern werden ca. 50 Mio.
Angehörige von ca. 1000 indigenen Völkern
vermutet.
Von: Theo
Rathgeber, GfbV-Deutschland
 Dekade der
indigenen Völker
Dekade der
indigenen Völker
Lebenszeichen
einer anderen Welt
Millionen
Ureinwohner warten auf ein Zeichen aus den Industriestaaten, die
mit verantwortlich sind für den Rohstoff-Raubbau auf
indigenem Land. Die Folge des Raubbaus ist die Zerstörung
der Lebenswelten der indigenen Völker. Die Ureinwohner
beginnen sich aber gegen die Enteignung ihrer Heimat zu wehren.
Sie haben sich weltweit organisiert, um ihre Land- und die
Menschenrechte einzufordern. Sie fordern, daß ihre Staaten
in der noch laufenden UNO-Dekade indigener Völker
(1994-2004) die ILO-Konvention 169 zum Schutz der indigenen
Völker ratifizieren. Diese Konvention der Internationalen
Arbeitsorganisation ILO (ein UNO-Gremium) sichert die Landrechte.
Seit 1982 arbeiten Vertreter indigener Völker an der
UN-Arbeitsgrupe für indigene Bevölkerungen mit. Ziel
dieser Arbeitsgruppe (ist Teil der Unterkommission zur
Verhütung von Diskriminierung und zum Schutz der
Minderheiten der UN-Menschenrechtskommission) ist die
Ausarbeitung einer Erklärung über die Rechte indigener
Völker als Zusatz der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte.
Eine neue
Partnerschaft für die Verlierer der
Geschichte
Die indigenen
Völker sind die Verlierer der Geschichte. Sie wurden und
werden von in- und ausländischen Invasoren um ihr
angestammtes Land und ihre Lebenswelten gebracht. Dies ist nicht
nur Geschichte sondern auch brutale Gegenwart. Von der Arktis bis
Feuerland, von Skandinavien bis Südafrika, von Sibirien bis
zu den Philippinen, von Japan bis nach Australien ringen die
indigenen Völker um Überleben und
Eigenständigkeit.
Menschenrechtsgruppen
unterstützen die indigenen Völker, eine neue
Partnerschaft entsteht mit dem Ziel:
- die
Öffentlichkeit auf das kulturelle Erbe aufmerksam zu machen,
welches die indigenen Völker entwickelt und bewahrt
haben,
- die Politiker
aufzufordern, die Belange der indigenen Völker zu
unterstützen. Die Öffentlichkeit sollte Druck auf die
Staaten ausüben, daß sie die Konvention 169 der ILO
ratifizieren. Genauso sollen die Staaten im reichen Norden sich
für die UN-Erklärung über die Rechte indigener
Völker engagieren,
- Selbsthilfeprojekte indigener Völker zu
unterstützen. Besonders Gemeinden können durch ihren
Beitritt zum internationalen Klimabündnis das Anliegen der
indigenen Völker im Amazonas-Gebiet zur Rettung des
Regenwaldes mittragen.
Das internationale
Klimabündnis
"Ein Bündnis zu
schließen bedeutet, daß unterschiedliche Ideologien
und Kulturen, die einem gleichen Problem gegenüberstehen,
sich zusammenschließen. In Europa ist es das Klima, bei uns
ist es das Problem der Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes,
unseres Landes. Hier gibt es Berührungspunkte, denn die
Umwelt ist ein gemeinsames Anliegen, an dem wir an verschiedenen
Stellen der Erde gemeinsam arbeiten können. Und es gibt eine
Voraussetzung, die respektiert wird: ein Bündnis wird
zwischen Gleichberechtigten geschlossen, keiner geht über
den anderen hinweg, sondern man steht sich ebenbürtig
gegenüber", so bewertete Evaristo Nugkuag, der ehemalige
Vorsitzender der Coica (Koordination der Indianerorganisationen
des Amazonasbeckens) das vor zehn Jahren gegründete neue
Nord-Süd-Bündnis zwischen westeuropäischen
Städten und Gemeinden sowie der Coica.
"Der beste Schutz der
Amazonas-Biosphäre ist der Schutz von Land, das von
indigenen Völkern als ihre Heimat bezeichnet wird, und die
Förderung von eigenen Modellen für das Leben in dieser
Biosphäre und für die Nutzung der Ressourcen"
heißt es in einem Papier der Coica. Die Coica fordert die
Anerkennung und Verteidigung indianischer
Landrechte.
Die Coica wendet sich
gegen die Politik der Schuldenerlässe für Länder
der Dritten Welt, wenn diese dafür die Regenwälder mit
der Errichtung von Naturparks schützen. Statt "Schulden
gegen Natur" schlagen die Indianerorganisationen einen Tausch
"Schulden gegen Land" vor. Die Coica wurde 1984 zur Verteidigung
der Rechte der Amazonasvölker gegründet. Mitglieder
sind die indianischen Amazonas-Organisationen, die 400
Völker und eine Million Menschen in den fünf
Anrainerstaaten vertreten:
- die interethnische
Vereinigung für die Entwicklung des Dschungels von Peru
(Aidesep) vertritt 21 Organisationen von 60 indianische
Völker mit 330.000 Angehörigen. Aidesep fordert
Landrechte und die Förderung von umweltschonenden
Wirtschaftsweisen,
- das Zentrum der
indianischen Gemeinschaften und Völker Ostboliviens (Cidob)
vertritt 9 Organisationen, 41 Völker mit mehr als 300.000
Angehörigen. Kämpft um die Anerkennung der
Multikulturalität Boliviens,
- die Koordination
der indianischen Organisationen im brasilianischen Amazonasgebiet
(Coiab) vertritt 150 Völker mit mehr als 200.000
Angehörigen und fordert die immer wieder
hinausgezögerte Land-Demarkierung,
- die
Konföderation indianischer Nationalitäten des
Amazonasgebiets von Equador (Confeniae), bestehend aus 9
Organisationen, die acht Völker mit 150.000 Angehörigen
vertritt. Die Confeniae verlangt die gleichberechtigte Teilnahme
der indigenen Völker Equadors an der Verwaltung des Staates.
Die Konföderation hat ein eigenes zweisprachiges
Bildungssystem aufgebaut,
- die Nationale
Organisation indianischer Völker Kolumbiens (Onic), in der
170 kleinere Völker (150.000 Angehörige)
zusammengeschlossen sind (ähnlich wie die bolivianische
Cidob kämpft die Onic um die Anerkennung des multinationales
Charakters Kolumbiens).
Von: Wolfgang Mayr,
GfbV-Südtirol
 Die UN
schulden uns eine Erklärung
Die UN
schulden uns eine Erklärung
Die indigenen
Völker fordern verbindlichen Schutz ihrer
Rechte
(...) Die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte war und ist eine
Antwort auf vielfache Verletzungen der Menschenwürde, die
bis heute in allen Teilen der Welt anhalten. Als international
geltendes Instrument stellte diese Erklärung einen enormen
Fortschritt für die Geltung und den Respekt vor den
unveräußerlichen Menschenrechten dar. (...) Aber nach
und nach verkehrt sich die UNO zu einem Ausdruck der herrschenden
Machtinteressen. Und so verkümmert auch die
Menschenrechtserklärung zu einem Prinzipienkanon, den
niemand zu erfüllen und zu respektieren
braucht.
Um diesen Niedergang
aufzuhalten, haben wir, die Opfer, Beleidigten und
Überfallenen, uns an die UNO gewandt, damit diese den Blick
auf diejenigen Länder richtet, in denen Menschenrechte nicht
existieren. (...) Die Vereinten Nationen müssen sich aber
einer vollständigen Überprüfung ihrer Arbeit
unterziehen und Reformen auf den Weg bringen. Dazu gehört,
daß die wirtschaftlichen, politischen, sozialen und
kulturellen Rechte zu einem Bestandteil der Menschenrechte
werden. Ebenso müssen die Vereinten Nationen das Thema
Selbstbestimmung und der kollektiven Rechte indigener Völker
sowie ethnischer und kultureller Minderheiten miteinbeziehen.
Denn diese sind in der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte nicht enthalten.
Daß die Rechte
der indigenen Völker in einer eigenen Erklärung der UNO
kodifiziert werden müssen, diese Notwendigkeit kam schon vor
etwa drei Jahrzehnten zu Sprache. 1982 schufen die Vereinten
Nationen die Arbeitsgruppe für indigene Bevölkerungen
(UN Working Group for Indigenous Populations). Eine seiner
Hauptanliegen lag darin, die Entwicklung internationaler Normen
zu den Rechten indigener Völker voranzutreiben. Von
großer Bedeutung war, daß die UNO der direkten
Teilnahme von indigenen Repräsentanten Raum gegeben hat. So
kam 1995 nach langen Diskussionen, zähem Ringen und vielen
schmerzlichen Kompromissen endlich ein Entwurf für die
angestrebte Erklärung zustande. So bin ich wenig
glücklich darübe, daß die
UN-Menschenrechtskommission den Entwurf fünf Jahre nach
seiner Überweisung noch immer nicht verabschiedet
hat.
Wir hoffen, daß
die Vollversammlung in einer entsprechenden Resolution die
Notwendigkeit betont, daß die Erklärung sich bis zum
Ende des Internationalen Jahrzehnts der indigenen Völker
2004 in einer Konvention über die Rechte indigener
Völker wandelt. Mit einer solchen Konvention würden wir
endlich (weil verbindlicher als eine Erklärung) ein
wirksames Instrument zur Verteidigung unserer kollektiven
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte
bekommen.
Aus: pogrom
(200/98), Zeitschrift für bedrohte Völker von Rigoberta
Menchú, guatmaltekische Menschenrechtlerin,
Friedensnobelpreistägerin und Goodwill-Botschafterin der UNO
(Angehörige des
Quiché-Volkes)
 Indigene
Völker und die UNO
Indigene
Völker und die UNO
Für indigene
Völker sind bisher folgende Rechtsnormen innerhalb des
Rechtsinstrumentariums der Vereinten Nationen (UN) erarbeitet
worden:
- die Deklaration
der Allgemeinen Menschenrechte 1948 (Artikel 1, 2, 4, 7, 17, 26
und 27)
- die Konvention zum
Verbot des Völkermordes 1951 (Artikel 2) und
die
- ergänzende
Konvention zur Abschaffung der Rassendiskriminierung
1969
- (Artikel 1.1) der
Internationale Vertrag über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte 1976 (1, 2, 3, 1 3, 15 und
25)
- der Internationale
Vertrag über zivile und politische Rechte 1976 (Artikel 1
und 27)
- das
Zusatzprotokoll des internationalen Vertrags über zivile und
politische Rechte 1976 (Präambel und in Artikel
1)
- die
UNESCO-Erklärung von San-José zu Ethnozid und
ethnischer Entwickiung von 1981 sowie
- die Konventionen
der ILO Nr. 1 07 (1957) und 169 (1989).
Die internationale
Staatengemeinschaft nahm die Probleme der indigenen Völker
in der postkolonialen Ära lange nicht zur Kenntnis. Es ist
der wachsenden politischen Mobilisierung der Betroffenen und dem
Engagement von Unterstützergruppen und -personen zu
verdanken, daß die indigenen Völker auch im UN-System
ein Thema wurden. 1972 wurde von der "Unterkommission zur
Vorbeugung von Diskriminierung und zum Schutz der Minderheiten"
der Vereinten Nationen eine ausführliche Studie zum Problem
der Diskriminierung indigener Völker in Auftrag gegeben. Die
1983 vorgelegte "Martínez-Cobo-Studie" nannte
Diskriminierung von und Menschenrechtsverletzungen an indigenen
Völkern beim Namen.
Diese Arbeit gab den
Anstoß für die Schaffung der "Arbeitsgruppe für
Indigene Bevölkerungen" (Working Group on lndigenous
Populations) die 1982 von der "Unterkommission für
Verhütung von Diskriminierung und Minderheitenschutz" der
UN-Menschenrechtskommission eingerichtet wurde. Sie tagt
jährlich in Genf und ist das einzige internationale Forum,
in dem Vertreterinnen indigener Völker (und zwar
unabhängig davon, ob sie von den Vereinten Nationen formal
anerkannt sind oder nicht) ihre lnteressen und Forderungen
darlegen und in einen offenen Dialog mit Regierungsvertretern
treten können. In der UN-Hierarchie hat die Arbeitsgruppe
jedoch wenig Einfluß, denn ihre Beschlüsse müssen
von vier übergeordneten Gremien abgesegnet werden: von der
Unterkommission zur Vorbeugung von Diskriminierung und zum Schutz
für Minderheiten, der Kommission für Menschenrechte,
dem Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC - hier hat die GfbV einen
Beobachterstatus) und schließlich die UN-Generalversammlung
(die ECOSOC gewährt zwölf Organisationen indigener
Völker einen Beraterstatus).
Von dar Arbeitsgruppe
gehen allerdings wichtige Impulse aus: Ihre Hauptaufgabe ist die
Erarbeitung internationaler Rechtsnormen für indigene
Völker. Sie versucht damit ein Vakuum aufzufüllen, da
viele der gültigen Menschenrechtsabkommen (siehe oben) nur
Individualrechte festschreiben und somit den
gemeinschaftlich-orientierten Charakter indigener Völker
nicht berücksichtigen. Artikel 1 der Charta der Vereinten
Nationen und auch die gleichlautenden Artikel 1 der beiden
Menschenrechtspakte lauten: "Alle Völker haben das Recht auf
Selbstbestimmung". Allerdings findet sich in der Charta keine
rechtsverbindliche Definition des Begriffs "Volk", und die
Nationalstaaten verweigern das den indigenen "Völkern"
zustehende Selbstbestimmungsrecht.
Außerdem
untersucht die Arbeitsgruppe für indigene Bevölkerungen
besondere Aspekte der Beziehung dieser Völker zu den
Nationalstaaten. Seit 1989 prüfen Experten (angeregt durch
eine Empfehlung des früheren Martínez-Cobo-Reports)
den völkerrechtlichen Status von Verträgen und
bilateralen Abkommen.
Die 1957
verabschiedete IL0-Konvention Nr. 1 07 wurde überarbeitet.
In den 50er Jahren strebte man eine möglichst schnelle
Integration und Assimilation indigener Völker an. Die
Konvention Nr. 107 konzentrierte sich daher auf den Schutz dar
Einzelperson und untersagte eine Diskriminierung seitens dar
Nationalstaaten. Aber in den letzten Jahren gewannen die
Prinzipien dar ldentitätsbewahrung und der Selbstbestimmung
international an Gewicht und veranlaßten die IL0, einen
Neuentwurf zu erarbeiten. Unter zumindest formaler Mitwirkung
indigener Völker (als Beobachter und Berater) verabschiedete
die IL0 1989 die neue Konvention Nr. 1 69. Dieser Text
bekräftigt, daß kein Staat und keine gesellschaftliche
Gruppierung das Recht hat, die ldentität zu leugnen, die ein
indigenes Volk für sich beansprucht, und überträgt
den Staaten die Verantwortung, unter Beteiligung der indigenen
Völker deren Rechte und Integrität
sicherzustellen.
Die Konvention Nr. 169
befaßt sich auch ausführlich mit Landrechten und
Ressourcennutzung. So heißt es in Artikel 14, Absatz
1:
"Die Eigentums- und
Besitzrechte der betreffenden Völker an dem von ihnen seit
alters her besiedelten Land sind anzuerkennen. Außerdem
sind in geeigneten Fällen Maßnahmen zu ergreifen, um
das Recht der betreffenden Völker zur Nutzung von Land zu
schützen, das nicht ausschließlich von ihnen besiedelt
ist, zu dem sie aber im Hinblick auf traditionelle, der
Eigenversorgung dienenden Tätigkeiten, Zugang haben
(Nomadenvölkern und Wanderfeldbauern)."
Weiter heißt
es in Artikel 15-
1. Die Rechte der
betreffenden Völker an den natürlichen Ressourcen ihres
Landes sind besonders zu schützen. Dies schließt das
Recht dieser Völker ein, sich an der Nutzung,
Bewirtschaftung und Erhaltung dieser Ressourcen zu
beteiligen.
2. In Fällen, in
denen der Staat das Eigentum an mineralischen oder unterirdischen
Ressourcen hält oder Rechte an anderen Ressourcen des
Landes, haben die Regierungen Verfahren festzulegen oder
aufrechtzuerhalten, mit deren Hilfe sie die betreffenden
Völker konsultieren, um festzustellen, ob und in welchem
Ausmaß ihre lnteressen beeinträchtigt werden
würden, bevor sie Programme zur Erkundung oder Ausbeutung
solcher Ressourcen ihres Landes durchführen oder genehmigen.
Die betreffenden Völker müssen angemessenen Ersatz
für alle Schäden erhalten, die sie infolge solcher
Tätigkeit erleiden.
Die Konvention Nr. 169
stellt auch fest, daß "unabhängig von ihrem
Rechtsstatus, indigene Völker ihre eigenen sozialen,
wirtschaftlichen, kulturellen und politischen lnstitutionen zum
Teil oder zur Gänze beibehalten
sollten".
Bisher haben
allerdings nur sieben Staaten ratifiziert: Mexico, Norwegen,
Costa Rica, Bolivien, Kolumbien, Holland und Dänemark. Es
waren insgesamt nur zwei Ratifizierungen notwendig, damit die
Konvention inkraft trat. Die Konvention 107 bleibt für jene
Regierungen gültig, die sie ratifiziert haben und die
Konvention 169 aber für "zu weitgehend"
halten.
Seit 1985 arbeitet die
Arbeitsgruppe für indigene Völker an der "Allgemeinen
Deklaration über die Rechte indigener Völker"
(Universal Declaration on the Rights of lndigenous Peoples).
Erstellt wird der Text von fünf Rechtsexpertinnen,
sogenannten "independent experts", unter dem Vorsitz der
Völkerrechtsexpertin Erica Daes (Griechenland), mit Hilfe
von Vertretern indigener NGOs (Non-governmental Organisations),
Menschenrechtsorganisationen und Staaten.
Es soll eine
Rechtsnorm gefunden werden, die als internationale Richtlinie
für das Zusammenleben mit indigenen Völkern dienen kann
und die vor allem deren gemeinschaftlich orientierter Lebensweise
Rechnung trägt. Die Arbeit geht sehr langsam voran, weil
nicht einmal die Definition indigener Völker unumstritten
ist. Viele verschiedene lnteressen müssen
berücksichtigt werden, denn die indigenen Völker bilden
keine homogene Gruppe. So leben z.B. die Cree im nördlichen
Kanada unter ganz anderen Umständen als die Penan im
tropischen Malaysia. Nicht zuletzt behindern auch viele
Regierungen die Fortschritte in der
Arbeitsgruppe.
Der Vorentwurf der
Deklaration ist in fünf Abschnitte
gegliedert:
Teil I bezieht sich
auf die Allgemeinen Universalen
Menschenrechte
Teil II behandelt die
kulturellen und ethnischen Rechte und den Schutz vor
Ethnozid
Teil III betrifft
Landrechte und Ressourcen, vor allem "das Recht auf Anerkennung
der besonderen und tiefen Beziehung indigener Völker zu
ihrer Umwelt, ihrem Land, ihren Gebieten und Ressourcen, die sie
traditionell bewohnen oder anderweitig nutzen",
- das Recht auf eine
eigene Ausprägung von Landbesitz,
- das Recht auf
"Schutz und Wiederherstellung ihrer gesamten Umwelt und der
Produktionskapazität ihres Landes und ihrer
Siedlungsgebiete",
- das Recht auf
Rückforderung von Land und Oberflächenressourcen oder,
wo nicht möglich, auf angemessenen Schadensersatz, wenn das
Eigentum ohne ihre Zustimmung enteignet wurde;
- das Recht, zu
verlangen, daß Staaten indigene Völker konsultieren,
bevor mit Großprojekten begonnen wird, die auf Nutzung und
Ausbeutung natürlicher Ressourcen abzielen, um negative
wirtschaftliche, soziale, kulturelle und ökologische
Auswirkungen abzuschwächen. lm Falle negative Auswirkungen
soll Schadensersatz geleistet werden.
Teil IV beinhaltet
wirtschaftliche und soziale Rechte, einschließlich der
Erhaltung der traditionellen wirtschaftlichen Strukturen und
Lebensweisen
Teil V bezieht sich
auf zivile und politische Rechte. Es geht vor allem um die
Achtung des eigenständigen Rechtssystems und der politischen
und sozio-ökonomischen lnstitutionen indigener Völker,
um Mitbestimmung in der nationalen Politik und das kollektive
Recht auf Autonomie.
Die Definition des
Begriffs Selbstbestimmung und das ausdrückliche Recht
indigene Völker, die auf ihren Territorien vorhandenen
Ressourcen zu kontrollieren, sind nach wie vor
umstritten.
Die Nutzung der
Ressourcen soll im Sinne der indigenen Völker an deren
Zustimmung gebunden sein. Sie wollen, daß der Rohentwurf
zur Deklaration den Begriff Ressourcen ausdrücklich
enthält und behandelt. Doch durch die lntervention einiger
Staaten droht eine Verwässerung dieser (kollektiven)
Kontrollmöglichkeiten.
Besonders die
Diskussion um das Selbstbestimmungsrecht wird sehr zäh
geführt. Regierungen wollen den indigenen Völkern
dieses Recht nur innerhalb nationalstaatlicher Strukturen
zugestehen. Indigene Vertreter fordern jedoch vehement, daß
der Begriff Selbstbestimmung ohne Einschränkung in der
Deklaration verankert werden soll, um ihm dieselbe Qualität
zu verleihen, wie sie auch für die anderen Normen der
Vereinten Nationen gilt.
1993 wurde von der UNO
das "Jahr der indigenen Völker" ausgerufen. Es steht unter
dem Motto "Eine neue Partnerschaft". Die Staaten sind
aufgefordert, die schon bestehende und rechtskräftige
Konvention Nr. 169 "Zum Schutz der indigene Völker" zu
ratifizieren. Viele europäische Länder lehnen dies mit
der Begründung ab, es gebe keine indigenen Völker auf
ihren Territorien. Die Frage der Beziehung indigener Völker
zu ihrer Lebenswelt ist eine menschenrechtliche Frage und somit
nicht allein die innere Angelegenheit eines Staates. Die
weltweiten wirtschaftlichen Vernetzungen tragen - wie im Falle
des Tropenholzexportes - dazu bei, die Lebensgrundlagen indigene
Völker zu zerstören.
Aus: Bedrohte
Völker - Indigene Völker/Menschenrechtsreport der
Gesellschaft für bedrohte
Völker
 Wird es
wärmer?
Wird es
wärmer?
Klimaänderung
durch Treibhauseffekte
Die Quelle nahezu
aller Energieumwandlungsprozesse ist die Sonne. Ihre kurzwellige
Strahlung wird von der Erdoberfläche und der Atmosphäre
teilweise reflektiert, der absorbierte Teil erwärmt die
Erde. Die Abgabe (Kühlung der Erde) der Wärmeenergie an
den Weltraum erfolgt in Form langwelliger Strahlung. Gäbe es
keine Atmosphäre, so wäre es auf der Erdoberfläche
abwechselnd glühend heiß und eiskalt. In
Bodennähe würde - wie auf dem Mond - eine mittlere
Temperatur von lebensfeindlichen -18 Grad C herrschen.
Tatsächlich liegt sie jedoch bei rund + I5 Grad
C.
Der
natürliche Treibhauseffekt (THE)
Diese
Temperaturdifferenz ergibt sich, weil bestimmte Gase der
Atmosphäre (vor allem Wasserdampf und Kohlendioxid CO 2)
für die verschiedenen Wellenlängen nicht gleich gut
durchlässig sind. Sie absorbieren die langwellige
Abstrahlung der Erde stärker als die kurzwellige (Sonnen-)
Einstrahlung. Sie wirken daher wie eine Strahlungsfalle. Das
gesamte System Erde erwärmt sich somit. Die mittlere
Erdtemperatur ist nun jene, bei der sich Energieabgabe und
Energiezufuhr das Gleichgewicht halten. Wird die Energieabgabe,
d.h. die Wärmeabgabe durch treibhauswirksame Gase behindert,
so erhöht sich die Erdtemperatur.
Der Mensch
beeinflußt die Atmosphäre
Durch die zunehmende
Industrialisierung und die wachsende Bevölkerungszahl ist
die Konzentration einiger Treibhausgase seit etwa 1780 immer
stärker angestiegen, und neue treibhauswirksame Gase kamen
hinzu. Dieser zusätztiche, antropogene (durch den Menschen
verursachte) Treibhauseffekt verstärkt den natürlichen
THE.
Klimaänderungen bis heute - Das Klima ist
dynamisch
Vor etwa 5.000 Jahren
lag die mittlere Temperatur um 2 bis 3 Grad C höher als
heute. Die Baumgrenze war in den Gebirgen Europas um einige 100 m
höher. Untersuchungen an Eisbohrkernen in der Antarktis
belegen den Zusammenhang zwischen CO 2-Gehalt der Atmosphäre
und einer globalen Erwärmung bzw. Abkühlung. Deshalb
stellt auch CO-2 den bevorzugten Indikator für den
antropogenen THE dar.
Gegenwärtiger Trend
In jüngster Zeit
(von 1880 bis 1980) ist die globale mittlere Temperatur um 0,6
Grad C angestiegen. Der Anstieg des Meeresspiegels betrug in
diesem Zeitraum 10 bis 20 cm, und die Konzentration von CO 2
stieg von 280 ppm 1800 auf 354 ppm 1990 an. (1 ppm - parts per
million = 0,0001%).
Solche Werte gab es
zuletzt vor einigen 100.000 Jahren. Klimaprognosen können
sich daher auf keinerlei Erfahrung stützen, zumal die
Anstiege von Temperatur und CO 2-Gehalt in den letzten 10.000
Jahren vermutlich noch nie so schnell erfolgten wie
heute.
Zukünftige
Klimaänderungen und deren Folgen
Die meisten
Klimaforscher gehen von einer Verdoppelung der CO 2-Konzentration
gegenüber der vorindustriellen Zeit aus. Dies wäre bei
unveränderten Emissionstrends um das Jahr 2025 der Fall.
Weitgehende Übereinstimmung unter den Wissenschaftlerlnnen
herrscht darüber, daß unter dieser Bedingung ein
globaler Temperaturanstieg von etwa 1,5 - 4, 5 Grad C bis zum
Ende des nächsten Jahrhunderts erfolgen würde. Extreme
Wettererscheinungen (schwere Stürme, Hitzeperioden,
Überschwemmungen) würden sich
häufen.
Der 1995
veröffentlichte 2. Situationsbericht des IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change) bestätigt den
befürchteten Trend zur globalen
Erwärmung:
- Im 20. Jahrhundert
sind die Temperaturen durchschnittlich weit höher als in den
vorhergehenden 600 Jahren.
- Es wird erwartet,
daß die Temperatur bis zum Ende des kommenden Jahrhunderts
um 2 Grad C ansteigen wird; vor allem in den nördlichen
Breiten wird es zu einer stärkeren Erwärmung
kommen.
- Das Meereswasser
wird sich auch in tieferen Schichten erwärmen - 2100 wird
ein Anstieg des Meeresspiegels um 15 - 95 cm
erwartet.
- Die Klimazonen
verschieben sich in Richtung der Pole;
- viele Pflanzen und
Tiere werden nicht in der Lage sein, sich diesen
Klimaänderungen anzupassen und werden daher
aussterben;
- extreme
Wettererscheinungen werden sich häufen.
Klirmaszenario
für Italien
Trotz aller
Mängel der Klimamodelle kann für die Zeitspanne 2025 -
2030 von folgenden Szenarien ausgegangen
werden:
die durchschnittlichen
Temperaturen werden im Mittelmeerraum um 1,2 - 3,5 Grad C
zunehmen;
die sommerlichen
Regenfälle werden weiter zurückgehen, während es
im Norden (vor allem in den Wintermonaten) intensiver regnen
wird;
der Meeresspiegel wird
um 12 - 18 cm ansteigen; die Erosion der Küsten nimmt zu,
Salzwasser wird in die Wasseradern eindringen und die
Trinkwasserversorgung erschweren;
extreme
Wettererscheinungen (z.B. Stürme, Unwetter,
Überschwemmungen) werden sich auch in Italien
häufen;
die Erhöhung der
Durchschnittstemperatur wird sich vor allem auf die sensiblere
Pflanzenwelt auswirken; betroffen sind u.a. auch die
kältegewohnten Pflanzen der Alpenregion.
Weltweite
Folgen
Dramatischer als in
Mitteleuropa könnten Klimaänderungen in anderen
Gebieten der Erde ausfallen: Dürrekatastrophen,
fortschreitende Wüstenbildung, häufigere tropische
Stürme, Überschwemmungen großer
Küstengebiete. Betroffen davon wären vor allem
Länder, die ohnehin schon unter großer Amut
leiden.
Man muss jetzt
etwas tun - das Toronto-Ziel
Auch Italien muß
sich dringend an emissionsmindernden Maßnahmen beteiligen.
Für CO 2 empfiehlt die UN-Weltklimakonferenz von Toronto bis
zum Jahr 2005 eine Reduktion der Emissionen um 20% (bezogen und
berechnet auf 1988). Das würde zwar noch lange keine
Reduktion des tatsächlichen CO 2 Gehaltes der
Atmosphäre bedeuten, aber Klimaänderungen
möglicherweise verzögern. Von diesem Toronto-Ziel sind
aber die meisten Staaten weiter entfernt als je. Österreich
z. B. lag 1992 um 43% über dieser Vorgabe. Für die
Reduktion anderer Treibhausgase, ausgenommen FCKW, fehlen immer
noch weltweite, verbindliche Verpflichtungen.
Wer hat
Schuld?
Die Verursacher des
zusätzlichen THE ( Industrie, Verkehr, Energieerzeugung,
Landwirtschaft) sind - trotz geringerer Bevölkerungszahlen -
vor allem in den reichen Industrieländern des Nordens zu
finden. Der Anteil der Entwicklungsländer dürfte jedoch
infolge des Bevölkerungswachstums und der steigenden
Industrialisierung stark steigen. Die Forschung wird auch in den
nächsten Jahren keine Klimaprognose vorlegen können,
die auch die letzten Entscheidungsträger überzeugen
wird. Eine abwartende Haltung bedeutet aber, beim
größten Experiment, das die Menschheit bisher
ausgeführt hat, tatenlos zuzusehen. Selbst wenn
sämtliche klimarelevanten Emissionen vollkommen gestoppt
werden, würde es wegen der langen Verweilzeit mancher Gase
in der Atmosphäre mehr als 100 Jahre bis zu einem
Rückgang der Konzentrationen dauern.
Gibt es
Lösungen, Alternativen?
Angesichts der
gegebenen Situation ist ein anderes Wirtschaften angebracht. Vor
allem die reichen Länder des Nordens sind angehalten,
nachhaltig zu wirtschaften: sozial- und umweltverträglich
sowie ressourcenschonend. Sparsamkeit im Umgang mit Energie und
Vorrang für erneuerbare Energien, Forderungen sowohl die
Politik wie an jeden einzelnen. Die Entwicklung der
südlichen Welt nach dem Vorbild der Industrieländer
kann als gescheitert betrachtet werden. Für die nachhaltige
Nutzung des Regenwaldes gibt die indigene Bewirtschaftungsform
das beste Beispiel. Die - nachwachsenden - Schätze des
Regenwaldes sind in der traditionellen Bewirtschaftungsform weit
besser nutzbar als durch Holzeinschlag und
Viehzucht.
Entschuldung
Ein Verzicht des
Nordens auf ungehemmtes Wachstum, aber auch konkrete Schritte zur
Entschuldung der drückendsten Schuldenlasten der
Entwicklungsländer sind notwendig. Diese verhindern in
vielen Ländern eine Befreiung aus Armut und Elend. Der
künftige Weg sollte über ein ökologisch schonendes
Wachstum, verbunden mit der Sicherung der Grundbedürfnisse
der Bevölkerung, führen.
Klimabündnis
Das 1990 initierte
Klimabündnis zwischen europäischen Gemeinden und den
Ureinwohnergemeinschaften am Amazonas ist ein Versuch, der
Klimaveränderung und damit der Zerstörung der
Lebensgrundlagen entgegenzuwirken. Die indigenen Völker
haben sich in der COICA, der Koordination indianischer
Organisationen des Amazonasbeckens, zusammengeschlossen. Das
gemeinsame Ziel der Klimabündnispartner ist, Schritte zur
Erhaltung des Weltklimas zu setzen. Durch den Beitritt zum
Klimabündnis verpflichten sich sowohl die europäischen
als auch die amazonischen Bündnispartner initiativ zu werden
und Maßnahmen zu setzen.
Was will die
COICA?
- territoriale
Rechte der indianischen Völker (Landdemarkation) zum Schutz
vor dem weiteren Eindringen von Firmen und Privatpersonen
(Goldgräber);
- die
Selbstbestimmung der indigenen Völker und die Respektierung
der politischen, kulturellen und ökonomischen
Menschenrechte.
Die
europäischen COICA-Partner haben sich
verpflichtet:
- Die CO2-Emissionen
um 50% bis zum Jahr 2010 zu reduzieren,
- die Produktion und
den Verbrauch von FCKW sowie anderer treibhauswirksamer Gase zu
stoppen,
- auf die Verwendung
von Tropenholz zu verzichten,
- die amazonischen
Indianervölker beim Erhalt des tropischen Regenwaldes
finanziell und ideell zu unterstützen.
Südtirol -
Equador
In dieser globalen
Partnerschaft arbeiten die Südtiroler Gemeinden und die
Landesverwaltung vor allem mit den Indianergemeinschaften im
Regenwald Ecuadors zusammen. Diese Völker sind in der
Confeniae (Föderation indianischer Organisationen aus dem
ecuadorianischen Regenwald) zusammengeschlossen. In diesem Gebiet
leben neun Indianervölker mit unterschiedlicher Sprache und
Kultur. Einige davon umfassen nur mehr wenige Familien und sind
vom Aussterben bedroht; so zum Beispiel die Völker der
Zaparos, der Siona, der Secoya und der Cofàn. Das
größte Volk sind die Quichas Amazoniens, mit insgesamt
13 verschiedenen Volksgruppen. Außerdem leben noch Shuar
und Achuar, die Shiwiar sowie die Huaorani im ecuadorianischen
Urwald.
In den siebziger
Jahren wurde Erdöl entdeckt. Obwohl die
Erdölförderung mit hohen Kosten verbunden ist, begannen
dank großzügiger staatlicher Subventionen einige
multinationale Konzerne mit den Bohrungen. Dabei wurden weder die
Rechte der einheimischen Indianervölker berücksichtigt,
noch wurden irgendwelche Umweltauflagen eingehalten. Die Folge
ist eine großflächige Vergiftung und Zerstörung
des Regenwaldes. Die Indianervölker fordern nun eine
Wiedergutmachung der Schäden, die Einstellung der
Bohrtätigkeit in den Naturparks und eine
Berücksichtigung der Umweltgesetze.
Unterstützt
werden sie dabei von ihren Klimapartnern aus Südtirol. In
Lago Agrio, einer Kleinstadt im Regenwald, wurde mit Mitteln der
Südtiroler Landesregierung und mit Spendengeldern aus dem
"Projekt Schmetterling" ein Umweltzentrum errichtet. Dort
erhalten die Menschen Unterstützung und Beratung im Kampf
für ihre Rechte. Auch in anderen gefährdeten Gebieten
Ecuadors sollen ähnliche Beratungs- und
Überwachungszentren errichtet werden.
Das
Klimabündnis in Südtirol
In Südtirol sind
inzwischen 54 Gemeinden dem Klimabündnis beigetreten. Die
Koordinationsstelle Klimabündnis Südtirol, die beim
Landesamt für Luft und Lärm angesiedelt ist,
unterstützt die Mitgliedsgemeinden in ihren
Klimaschutzaktivitäten. In der Arbeitsgruppe
Klimabündnis sind vertreten:
Landesamt für
Luft und Lärm, Öko-Institut, Ecolnet und die
Gesellschaft für bedrohte Völker.
Die
Klimabündnisgemeinden haben mit der Erstellung der
Klimaberichte begonnen. Dies ist ein erster Schritt zur
Energieeinsparung, denn durch die Kenntnis des Ist-Zustandes
werden die Schwachstellen an Gebäuden, Technik und falsches
Nutzungsverhalten deutlich. Die Energiesparmaßnahmen
entlasten die Gemeindehaushalte durch Kostensenkung und sind ein
Beitrag zum Klimaschutz. Grundpfeiler dieser Strategie
sind:
Energieeinsparung,
Erhöhung der Energieeffizienz, Verstärkter Ausbau
erneuerbarer Energieträger,
Verkehrsvermeidung/-verminderung.
Aus: "Klima
verbündet" - Informationsheft für
Lehrer/Innen/Koordinationsstelle Klimabündnis im Landesamt
für Luft & Lärm/Red.
Ecolnet
 Der
Treibhauseffekt
Der
Treibhauseffekt
Was geht das uns
an?
Von den
menschlichen Aktivitäten, die zum verstärkten
Treibhauseffekt beitragen, machen die Energieerzeugung und
Energienutzung mehr als die Hälfte aus. 88% des weltweiten
Energiebedarfs stammt dabei aus fossilen Energieträgern, 7%
aus erneuerbaren Energiequellen (Wasser, Wind, Biomasse) und 5%
aus Kernenergie. Dabei verbrauchen wir Europäer ein
Vielfaches der Energie eines Afrikaners oder Asiaten und setzen
dabei jährlich 20 Gigatonnen CO-2 frei.
FCKW
Die Verwendung von
FCKW als Kühlmittel (in Eiskästen, Klimaanlagen etc.),
als Lösungsmittel (in Farben, Lacken und Reinigungsmitteln),
als Treibgas (in Spraydosen) oder in Kunststoffen zum
Schäumen ist ein weiterer Beitrag zum
Treibhauseffekt.
Landwirtschaft
Durch die intensive
Landwirtschaft werden immer größere Mengen von
Stickstoff in den Boden eingebracht. Ein großer Teil wird
durch die Tätigkeit der Bodenbakterien wieder als Lachgas (N
2 0) freigesetzt. Die Fleischproduktion wird zur
Massentierhaltung und setzt - genauso wie intensiver Reisanbau -
große Mengen an Methan (CH 4) frei. Durch unser
Kaufverhalten fördern auch wir die Freisetzung von
Treibhausgasen.
Abholzung
Fast 15% nimmt
schließlich die Abholzung riesiger Waldflächen in
allen Teilen der Erde ein, die den Treibhauseffekt
verstärkt: Die Verbrennung des Waldes setzt große
Mengen an CO 2 frei und zerstört gleichzeitig diejenigen
Lebewesen, die sehr viel CO 2 binden können.
Anschließend werden die gewonnenen Flächen oft
für intensiven Ackerbau genutzt.
Die Situation in
Italien
Laut einer Studie des
World Ressources Institute trägt Italien mit einer
Verschmutzungsquote von zwei Prozent zur weltweiten
Klimaveränderung bei. In dieser Studie liegt Italien
weltweit an 11. Stelle bei der Emmission von Kohlendioxyd, FCKW
und Methan (die stärksten italienischen C0-2-"Produzenten"
sind die Industrie, die privaten Haushalte und die Industrie).
Die Umweltberatung des Forums Wiener Hochschulen hat die CO
2-Emissionen eines Zweipersonenhaushalts in Österreich
berechnet und festgestlelt, daß jede/r Österreicher/In
jährlich 22 Tonnen C0 2 "produzieren".
Den Hauptanteil an C0
2-Emissionen nehmen die Konsumgüter ein: lhre Herstellung,
der Verkauf, der Gebrauch und die Entsorgung verbrauchen Unmengen
an Energie. Dazu kommt noch die eigene Mobilität - Auto und
Flugzeug. Die Hauptverursacher des verstärkten
Treibhauseffektes ist der reiche Norden der
Welt.
Wie kann ein
erfolgreicher Klimaschutz erreicht
werden?
Eher ernüchternd
ist die Bilanz der bisherigen internationalen Klimaschutzpolitik.
Konkrete Reduktionswerte für CO2- Emissionen und zeitliche
Ziele wurden zwar immer wieder diskutiert, blieben aber
unverbindlich. Der einzige klimarelevante Bereich, in dem bisher
Fortschritte erzielt werden konnten, ist die Eindämmung der
FCKW. In Montreal beschloß die internationale Gemeinschaft
den (zeitverzögerten) totalen Ausstieg.
Maßnahmen
in ltalien
Italien hält sich
grundsätzlich an die Empfehlung der Toronto-Konferenz von
1988. Mit den anderen europäischen Staaten wurde vereinbart,
den Ausstoß von CO 2 zu stabilisieren: Die Emissionen im
Jahre 2000 sollten auf den Stand von 1990 eingeschränkt
werden.
Das internationale
Rahmenabkommen zum Klimaschutz, auf der Umweltkonferenz von Rio
de Janeiro 1992 ausgearbeitet und mehr als 150 Staaten
unterzeichnet, verpflichtet zu einer Bestandsaufnahme der
Emissionen von Treibhausgasen. Es wurde ermittelt, daß die
wichtigsten Treibhausgase (CO 2, CH 4 und N 2 0) 1990 eine
Nettoemission von umgerechnet 391 Millionen Tonnen CO 2 zur Folge
hatten.
Das
Klimaschutzprogramm der italienischen Regierung sieht einige
Maßnahmen vor wie die bessere der Nutzung der Ressourcen;
eine bessere Energieeffizienz in der industriellen Produktion, in
den Dienstleistungen und privaten Haushalten; Förderung der
technologischen Innovation; den sparsamen Umgang mit Rohstoffen
und Wiederverwertung von Abfällen in der Industrie;
Energieeinsparung durch Verlagerung der Warentransporte auf die
Eisenbahn und Förderung des öffentlichen
Verkehrs.
Auf Gemeindeebene
konzentrieren sich die wichtigsten Maßnahmen vor allem auf
vier Bereiche: Energie, Verkehr, Abfallbeseitigung und
Grünschutz .Der Betritt von Gemeinden zum Klimabündnis
sorgte für neue Impulse.
Aus: "Klima
verbündet" - Informationsheft für
Lehrer/Innen/Koordinationsstelle Klimabündnis im Landesamt
für Luft & Lärm/Red:
Ecolnet
 Landdemarkation zum Schutz des
Regenwalds
Landdemarkation zum Schutz des
Regenwalds
Die Südtiroler
Klimabündnispartner unterstützen Indianer in
Ecuador
In keinem anderen
Teil des Amazonasbeckens verschwindet der Regenwald schneller als
im amazonischen Teil Ecuadors. Dabei zählt dieses Gebiet von
der doppelten Größe Österreichs zu den
artenreichsten Regionen der Erde. Viele der Tier- und
Pflanzenarten sind endemisch, d.h. sie sind einmalig auf der
Welt. Tausende von Arten sind noch gar nicht einmal
entdeckt.
Der Regenwald ist aber
auch Heimat für sieben eingeborene Indianervölker: die
Quichua, Shuar, Achuar, Cofan, Siona, Secoya und Huaorani.
Über Jahrtausende haben diese kleinen Völker, die
zusammen nicht mehr als 200.000 Menschen zählen, das
ökologische Gleichgewicht in diesem Raum bewahrt, mit und
von der Natur gelebt. Aber seit 1972 im Amazonasgebiet Ecuadors
Erdöl gefunden wurde, ist das sensible Gleichgewicht aus dem
Lot gekommen. Weite Gebiete wurden durch Straßen
erschlossen, immer mehr Zuwanderer auf der Suche nach schnellem
Gewinn kamen ins Land, die Förderung und der Transport des
„schwarzen Goldes“ führte zu einer
großflächigen Verseuchung. Dazu gesellten sich
Holzfäller, auswärtige Siedler, die
Ölpalmplantagen und Weiden anlegten, Pharmakonzerne auf der
Suche nach biologischen Wirkstoffen. Aber nicht nur das
ökologische Gleichgewicht ist bedroht, die
Erdölförderung hat auch tiefgreifende Folgen für
die Indianer. Nicht nur schwere Umweltbelastungen setzen ihnen
zu, sondern auch kulturelle und soziale
Entwurzelung.
Die Indianer, obwohl
Ureinwohner dieser Gebiete, wurden bei der Ausweisung der
Erdölgebiete nie gefragt. Rund ein Drittel der Gebiete in
ihrem Besitz sind bis heute noch nicht vermessen und rechtlich
zuerkannt worden. So hat die Regierung in Quito leichtes Spiel,
immer neue Gebiete für die „Prospektion“ (Tests
für Erdölvorkommen) auszuweisen. In vielen Regionen
existieren gleich drei Landeigentümer. An viele
Indianergemeinschaften sind in den letzten Jahren Landtitel
vergeben worden, die sich nur auf die Oberfläche beziehen.
Was darunter liegt, ist staatlicher Besitz und wird den
Erdölkonzernen in Konzession zur Nutzung vermacht.
Gleichzeitig weist der Staat oft Naturschutzgebiete aus,
schränkt diese Gebiete jedoch beliebig wieder ein, wenn dort
Erdöl oder andere Rohstoffe gefunden
werden.
Doch setzen sich die
Ureinwohner zur Wehr. Vom Urwald heraus sind sie schon vor 25
Jahren ins Rampenlicht der Öffentlichkeit getreten und haben
auf ihre Bedrohung aufmerksam gemacht. Sie haben sich zu
Verbänden und Föderationen zusammengeschlossen und
kämpfen für ihre Rechte, für ihr Land und für
ihre Lebensgrundlagen. Die Absicherung der Landrechte und die
Kontrolle der Erdölkonzerne hat dabei Vorrang. Daneben
bemühen sich die Indianer um das Recht auf die politische
Mitgestaltung der Amazonasprovinzen und auf die Kontrolle der
wirtschaftlichen Ressourcen dieser Gebiete.
Demarkiertes
Land - sicheres Land
In ihrem Kampf um
Landrechte bemühen sich die Indianerorganisationen Ecuadors
um internationale Unterstützung. Wie gerufen kam ihnen die
Gründung des Klimabündnisses 1992, mit dem sich
mittlerweile über 1000 europäischen Gemeinden und
Regionen verpflichten, die Erdatmosphäre und die
Regenwälder zu schützen.In diesem Sinne waren auch die
Südtiroler Klimabündnisgemeinden aufgerufen, konkrete
Projekte der Amazonasindianer zu unterstützen. 1997 wurde
die Erfassung der Umweltschäden durch die
Erdölförderung und die Überwachung der
Erdölkonzerne in einem sog. „Monitoring“
mitfinanziert.
1998 entschlossen sich
die über 50 Südtiroler Klimabündnisgemeinden, die
Demarkation von Indianerland mitzuunterstützen. Nur wenn die
Indianergemeinschaften wieder die Kontrolle über ihre
Gebiete in Form klar abgesicherter Landrechte erhalten,
können sie für eine nachhaltige Nutzung des Regenwaldes
sorgen. Die Demarkation (Grenzziehung und Vermessung) und die
rechtliche Verankerung dieser Grenzen sind unverzichtbare
Voraussetzung für einen echten Schutz. Damit können
Enteignungen verhindert und Eindringlinge jeder Art abgewehrt
werden. Sie bereitet auch den Weg für die Ausarbeitung eines
Schutz- und Entwicklungsplans für indianische Territorien
ohne rechtliche Anerkennung. Der Dachverband der ecuadorianischen
Indianer CONFENIAE hat sich zum Ziel gesetzt, das gesamte
Amazonasgebiet möglichst bald zu demarkieren. Mit dem
Landwirtschaftsministerium wurde ein Rahmenabkommen getroffen,
aber für die Finanzierung der Projekte müssen die
Indianer selbst aufkommen. Und dafür fehlt ihnen das
Geld.
Eine der am schwersten
betroffenen Provinzen Ecuadors ist die Provinz Sucumbíos
am nordöstlichen Eck des ecuadorianischen Amazonasgebiets.
Dort treffen mehrere Probleme zusammen: zum einen werden neue
Straßen Richtung Kolumbien und Brasilien gebaut; zum andern
sind neue Erdölförderungsgebiete ausgewiesen worden und
schließlich suchen sich kolumbianische Drogenkartelle dort
ein Refugium. Umso dringender war es, die Gebiete der Indianer
rechtlich sofort abzusichern, um gegen jede Bedrohung wirksamer
vorgehen zu können.
Das Projekt in dieser
Provinz umfasste folgende Schritte:
- die Vermessung des
Landes als Basis für die effektive Legalisierung und
Anerkennung der Indianergebiete;
- die Anerkennung
der festgelegten Grenzen auf dieser Grundlage durch die
staatlichen Behörden (das nationale Institut für
Agrarentwicklung);
- die Durchsetzung
staatlicher Garantien für Landtitel und Besitzrechte, die
für die Ureinwohner die Gefahr einer Vertreibung
ausschließen
- die Verankerung
und Sichtbarmachung der demarkierten Grenzen.
Die Projektträger
waren vor Ort die Indianergemeinschaften, die auf provinzialer
Ebene von den Verantwortlichen der CONFENIAE unterstützt
wurden. Dies ist das Bündnis der sieben indigenen
Völker des ecuadorianischen Amazonasgebietes und besteht
seit 1980. Sie gehört der COICA an, dem Dachverand aller
Indianervölker des Amazonasgebietes und Partner des
Klimabündnisses. Technische Unterstützung leistete das
FEPP, Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, eine kirchliche
Organisation, die seit Jahrzehnten in Ecuador mit großer
Kompetenz viele tausend Quadratkilometer Land für landlose
Kleinbauern und Indianer demarkiert hat. Finanziert wurde das
Projekt von den Südtiroler Klimabündnisgemeinden
mithilfe der Südtiroler Landesregierung; betreut wurde das
Projekt durch die Gesellschaft für bedrohte Völker.
1999 wurden die Arbeiten mit der amtlichen Registrierung für
sieben Gemeinden der Provinz Sucumbios abgeschlossen: Tigre
Playa, Santa Rosa, Yana Amarun, Pana Cocha, Riera, Pandu Yacu.
Aber noch zahlreiche weitere Indianergemeinschaften warten auf
die Demarkierung. Es braucht weitere tatkräftige und
finanzielle Unterstützung, um den „Hütern des
Regenwaldes“ zu ihrem Recht zu verhelfen.
Von: Thomas
Benedikter
 Das Haus von
Accìon Ecologica bei Lago Agrio -
Ecuador
Das Haus von
Accìon Ecologica bei Lago Agrio -
Ecuador
Dieses Haus ist
sowohl ein Zentrum zur Überwachung und Kontrolle des
Territoriums, ein Ausbildungszentrum, als auch ein Arbeitraum
für Indigene und Campesinos (Bauern).
Überwachungszentrum: Die Bevölkerung
weiss, dass sie sich an dieses Zentrum wenden kann, um Anzeige zu
erstatten, oder Informationen zu erhalten, über was sie
machen kann, wenn sie Probleme und/oder Auseinandersetzungen mit
der Erdölindustrie hat, und wie eine Anzeige erstattet
wird.
Ausbildungszentrum: Es
werden Kurse und Seminare über die verschiedenen Probleme,
die mit der Erdölproduktion zusammenhängen,
gehalten.
Arbeitsraum: Vor einem
Jahr wurde ein Abkommen zwischen Campesinos und Indigenas
unterschrieben, in dem vereinbart wird, dass beide Gruppen
gemeinsam zur Verteidigung des Amazonas arbeiten. Es werden
regelmässige Versammlungen zur Koordination dieser Arbeit in
der Struktur von Accion Ecologica abgehalten. Dabei versucht man,
andere Ortsgemeinschaften in dieses Projekt einzubeziehen, und
die territoriale Ueberwachungsarbeit selbst zu
machen.
Im Laufe des Jahres
1999 wurden mehrere Seminare, immer innerhalb der
Indigenas-Campesinos -Arbeit, abgehalten. Die Arbeitsgruppen
versuchen, einen Vorschlag zur Aenderung der Energie-politik
auszuarbeiten.
Ausbildungskurse
über Gesetze und Abkommen, über die Ueberwachungsarbeit
und über eine korrekte Handhabung der
Umwelt.
Regionales Forum:
dient zur Sammlung der Anzeigen aller Geschädigten durch die
Erdölgewinnung, und Information/diskussion über die
wahren Kosten der Erdölgewinnung.
Das Haus dient
ausserdem alks Treffpunkt: z.B. wurde dort das Treffen der
Jugendgruppen des Amazonas abgehalten, das Treffen der Missionare
der Carmelita-Mission, die Versammlung der Lehrer der Provinz,
ein Treffen der arbeiter der gemeinde.
Viele Leute und
Delegationen besuchen als erstes das Ueberwachubngszentrum, bevor
sie die vom Erdöl beschädigten Zonen und jene, die noch
ihre intakte Schönheit bewahrt haben,
besuchen.
Während des
letzten Ausbildungskurses (über korrekte Umwelthandhabung)
haben die Unterzeichner des Abkommens, die diese Struktur auch am
Meisten gebrauchen, eine Schätzung derselben gemacht, und
dabei hervorgehoben, welche die wichtigsten und nützlichsten
Sachen in ihr sind, welche im gegenteil verbessert oder
verändert werden müssen.
Besonders
hervorgehoben wurden: die Latrinen, die ihrer Mainung nach auch
in den eigenen Gemeinden eingeführt werden sollten; die
Sonnenenergie, dank der das Zentrum über kostenlose Energie
verfügt.
Es wurde
vorgeschlagen, ein grösseres und besser leserliches Schild
an der Haustür anzubringen, denn es passiert oft, dass Leute
das Haus nicht finden. Es wurden Verbesserungen für die
Handhabung der Abfälle vorgeschlagen, denn diese werden in
der Nähe des Hauses gesammelt und die getrennte Sammlung der
Abfälle funktioniert nicht gut.
Indigenas und
Campesinos haben gesagt:
"Mir gefällt
dieses haus, weil ich mich darin genauso gut wie in meinem
eigenen fühle." (Toribio Aguinda - Präsident der
Organisation der Cofan-Nation)
"Ich bin ein Indio,
ich kann nicht in einem Haus aus Zement leben" (Justino
Pillaguaje - Secoya, der einige Monate lang im Haus gelebt hat,
während er seine Arbeit als Professor zu Ende
brachte)
"Hier kann man sich
konzentrieren und gut arbeiten" (Angel Garcia -
Bauer)
"Das hier ist gut
gedacht und gut gebaut worden" (Angel Nieves -
Bauer)
"Hier ist es
schön und natürlich, deshalb komme ich auch mit meinen
Kindern hierher, damit sie sich auch hier gut fühlen
können" (Sra. Eligenia - Köchin bei den
Treffen)
Ein solches Haus,
mitten im regenwald und mit dem Nutzten, das es hat,
benötigt eine kostante Instandhaltung und andauernde
Aenderungen: z.B. muss nun das Dach des Hauses, dort wo die
Büros und Teil der Schlafsäle sind, neu gemacht werden,
denn diese Art von Dächern aus Palmen dauern kurze Zeit,
wenn im Haus nicht gekocht wird. Alejandro Criollo, der Schamane,
aus der Gemeinde der Cofan Dureno wird das neue Dach flechten. Er
wird es mit einer anderen, resistenteren Art von Palme, die man
weiter im Inneren des waldes findet,
flechten.
Es wurden auch andere
Verbesserungen vorgenommen, wie z.B. die elektrischen Leitungen,
Reparation der Dächer aufgrund des vielen Regens, der
Bewässerungskanäle, etc.
Das Haus ist ein
Vorbild für Estethik und Ruhe, in Mitten einer sehr
schwierigen Gegend. Dieses Haus ist irgendwie geschützt
(laut Alexandra Almeida), denn trotz der schwierigen
Verhältnisse in Lago Agrio (Gewalt, ausländische
Militärpräsenz, Diebstähle und Druck seitens der
Erdölindustrie) ist hier nie etwas passiert. "Es wurde nur
vor einigen Tagen eine Schlange gefunden", denn der wald wird
rundherum abgeholzt und die Tiere kommen hier her, um Zuflucht zu
suchen.
Von: Esperanza
Martinez
 Amazonien
Amazonien
Der Regenwald
brennt
Noch vor 200 Jahren
waren 11% der Erdfläche von tropischem Regenwald bedeckt.
Bis heute hat der Mensch fast die Hälfte davon schon
zerstört. Die Geschwindigkeit der Zerstörung ist kaum
vorstellbar: Pro Jahr gehen zwischen 100.000-250.000
Quadratkilometer verloren. Pro Minute sind es ca. 50
Fußballfelder.
Das Flußsystem
des Amazonas führt ein Fünftel der gesamten
Süßwasserreserven der Erde mit sich. Der Regenwald
beherbergt eine unvergleichliche Pflanzenfülle. In Amazonien
leben 30 bis 50% aller Pflanzen- und Tierarten der Welt. Es ist
unumstritten, daß es sich um eine der größten
Genreserven der Erde handelt.
Auf zehn Hektar
indonesischem Regenwald (ca. zwölf Fußballfelder) fand
man nicht weniger als 700 Baumarten - genauso viele, wie wir in
ganz Nordamerika kennen. Im Regenwald des kleinen Panama leben
genauso viele Arten wie in ganz Europa. Auf einem einzigen Baum
im Regenwald von Peru fand der amerikanische Biologe Edward
Wilson 43 Arten von Ameisen, genauso viele gibt es in ganz
England.
Klimafaktor
Regenwald
Durch die
Sonneneinstrahlung entstehen gewaltige Mengen an Wasserdampf. Da
der größte Teil dieses Wasserdampfes aus der lokalen
Verdunstung in Amazonien stammt, hat eine Abholzung des
Regenwaldes ein Absinken der Niederschläge und weitere
Klimaveränderungen zur Folge.
Berechnungen zufolge
nimmt Amazonien jährlich 1,2 Milliarden Tonnen CO 2 auf und
absorbiert damit rund ein Viertel der Menge, die weltweit durch
die Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas freigesetzt
wird. Auf der anderen Seite werden in Amazonien - durch
Brandrodung - erhebliche Mengen CO2
freigesetzt.
Faktoren der
Vernichtung - Kommerzieller Holzeinschlag
Er trägt zwar in
geringerem Maße zur Zerstörung des Regenwaldes in
Amazonien bei als in Afrika und Asien - immerhin waren 1987 aber
allein im brasilianischen Bundesstaat Rondonia 484 Holzfirmen
tätig. Sowohl durch das Anlegen der Einschlagschneisen als
auch beim Fällen einzelner Bäume werden zahlreiche
umstehende Bäume geschädigt. Bei einer vorgesehenen
Nutzung von 5% des Baumanteils werden etwa 60% des Waldbestandes
in Mitleidenschaft gezogen.
Brandrodung
Der
Brandrodungsfeldbau wurde erst problematisch, als zunehmend
Farmer den Wald großflächig mit staatlicher
Unterstützung zerstörten. Anfang der siebziger Jahre
lockte die Regierung hunderttausende landlose Bauern nach
Amazonien. Jedem Siedler wurden 100 ha Land versprochen, neue
Dschungelstädte entstanden.
Vieh-und
Plantagenwirtschaft
Das Weideland in
ehemaligen Regenwaldgebieten ist meist nicht sehr ergiebig. Rasch
ist der Boden ausgelaugt und nach etwa drei bis fünf Jahren
muß neues Land gewonnen werden. Die Rinderzucht wird in
Amazonien hauptsächlich von einheimischen
Großgrundbesitzern und ausländischen
Großkonzernen betrieben. Das Fleisch wird exportiert und
vorwiegend zu Tierfutter oder Fastfood verarbeitet. Das gilt auch
für die Nahrungs- und Genußmittel, die auf riesigen
Plantagen angebaut werden.
Raubbau durch
Bergbau
Im brasilianischen
Bundesstaat Parà im südöstlichen Amazonasgebiet
liegt das größte Eisenerzlager der Erde: Grande
Carajàs. Seit Anfang der achtziger Jahre entstehen auf
einem Gebiet, das heute immer noch zur Hälfte mit Regenwald
bedeckt ist und in dem 13.000 Indianerlnnen leben, zahlreiche
Bergwerke und Verhüttungsanlagen einschließlich der
notwendigen Infrastruktur. Das sind Eisenbahnlinien und Stauseen
zur Energieerzeugung. Beispiel eines solchen Kraftwerkes ist der
Staudamm Tucurui. Sein Strom ist für die Aluminiumschmelzen
bestimmt. 240.000 ha intakter Regenwald wurden
überflutet.
Zu einfach wäre
es, den Amazonasstaaten die alleinige Verantwortung für die
Regenwaldzerstörung zuzuweisen. Es gibt zahlreiche
Verbindungsstränge, die unser Leben mit der Situation in
Amazonien in Zusammenhang bringen.
Erze
Europa bezieht
große Mengen an Rohstoffen aus Brasilien. Das Land ist
nicht nur der größte Exporteur von Eisenerz, sondern
auch der billigste Anbieter. Für das Abbaugebiet Grande
Carajas wurde die nötige Investitionssumme von vier
Milliarden US $ von Banken aus USA, Europa und Japan sowie der
Weltbank in Form von Anleihen zur Verfügung gestellt.
Brasilien mußte sich verpflichten, diesen Staaten Eisenerz
langfristig und zu Preisen unter dem Weltmarktniveau
anzubieten.
Aluminium
Bauxit, der Rohstoff
zur Aluminiumgewinnung, wird in Amazonien abgebaut und unter
enormem Energieeinsatz zu Rohaluminium weiterverarbeitet.
Insbesonders für die Aluminiumverhüttung werden riesige
Wasserkraftwerke gebaut. Die Industrieländer sind auch
direkt an der Erschtießung von Bodenschätzen und deren
Verarbeitung beteiligt.
Holz
Österreich z.B.
importiert 30.000 t Tropenholz pro Jahr aus verschiedenen
Ländern - Holz, das zu 99% aus Raubbau stammt. Im niedrigen
Einkaufspreis sind keine Kosten für Aufforstung oder
Waldpflege enthalten. Und was wird damit erzeugt? Fensterrahmen,
Spielzeug, Leisten, Klobrillen, Särge.
Soia
...
Etwa vier Millionen
Kleinbauern und Landarbeiter verloren durch Umbau der
Landwirtschaft auf Exportprodukte wie Soja oder Kaffee ihre
Existenzgrundlage. Viele von ihnen reihen sich nun in den Strom
derer ein, die auf der verzweifelten Suche nach Land in das
Amazonasgebiet ziehen, die Indianerlnnen aus ihren
Siedlungsgebieten verdrängen und den Regenwald
niederbrennen. Die Hälfte der Sojaexporte Brasiliens geht in
die Europäische Union. Auch europäische Schweine
ernähren sich davon. Pro Jahr werden 65.000 t
brasilianisches Soja importiert. In Brasilien wird auf 20% der
gesamten Ackeranbaufläche Soja gepflanzt. Seit der
Forcierung der Sojaexporte muß Brasilien (teure)
Lebensmittel importieren.
... und andere
Exportkulturen
Exportkulturen wie
Kaffee, Tee, Kakao, Bananen und Ananas wachsen auf ehemaligen
Regenwaldgebieten. Auf den Plantagen arbeiten vielfach auch
Kinder, Pestizide werden rücksichtslos eingesetzt und die
Arbeiter erhalten keine gerechte Entlohnung.
Weltwirtschaft
und Verschuldung
Brasilien gehört
zu den am höchstenverschuldeten Staaten der Welt. Dadurch
sieht sich Brasilien - wie so viele andere
Entwicklungsländer - gezwungen, die Rohstoffexporte zu
erhöhen, um Devisen für die Rückzahlung der Zinsen
zu erwirtschaften. Die Folge ist Raubbau an der
Natur.
Ungelöste
Landfrage
Die Ursachen für
die Zerstörung Amazoniens sind auch im Land selbst zu
suchen. Eine gerechtere Verteilung des Landbesitzes (98% der
Bauern besitzen nur 13% der bebaubaren Fläche) ist noch
immer nicht erreicht.
Ungleichgewicht
Nord-Süd
In den
Industrieländern lebt nur ein Viertel der
Weltbevölkerung, dennoch werden dort 80% der Energie
verbraucht. Damit trägt der reiche Norden den
überwiegenden Anteil zum künstlichen Treibhauseffekt
bei. Unser Lebensstil und Wohlstand werden durch die billigen
Rohstoffe mitfinanziert, die wir aus Ländern der Dritten
Welt beziehen.
Aus: "Klima
verbündet" - Informationshef für
LehrerInnen/Koordinationsstelle Klimabündnis im Landesamt
für Luft & Lärm/Red:
Ecolnet
 Zerstörung von Lebensraum und Kultur der
indianischen Völker
Zerstörung von Lebensraum und Kultur der
indianischen Völker
Elf
Thesen
1) In Lateinamerika
stehen sich zwei Kulturen gegenüber. Die westliche Kultur
der einheimischen Oberschicht und die Kultur der Kleinbauern, der
Landarbeiter, der Straßenhändler. Einen besonderen
Stellenwert haben in diesem Zusammenhang die lndianer, die
ursprünglichen Bewohner und Besitzer des Landes, die
zurückgezogen in den bergigen und waldreichen Regionen
leben
2) Die westliche
Zivilisation droht, andere Kulturen zu überrollen und
verdrängt die einheimische
Bevölkerung.
3) Ackerbau und
Viehzucht in den Anden sind darauf ausgerichtet, die
Selbstversorgung der Gemeinschaft zu erzielen. Mit der
Fremdherrschaft begann der Landraub. Die Basis der lndios wurde
stark eingeschränkt, ihre wirtschaftliche Autonomie ging zum
großen Teil verloren.
4) Auch die
Landreformen änderte nicht viel. Die indianischen
Gemeinschaften, ursprüngliche Eigentümer, gingen leer
aus.
5) Mit der
Zerstörung der Subsistenzwirtschaft sind die Indios auf die
städtischen Märkte angewiesen. Der Markt ist der
Schnittpunkt, an dem den indianischen Kleinbauern ihre Produkte
für wenig Geld abgekauft und industrielle Fertigprodukte zu
hohen Preisen an sie verkauft werden.
6) Mit der zunehmenden
Produktion für den Markt sind weitreichende ökologische
Schäden verbunden, die zum Rückgang
landwirtschaftlicher Erträge führen und die
bäuerliche Existenz bedrohen.
7) Die moderne
Eroberung geschieht unter Verwendung moderner Technologien. Die
Organisations-, Arbeits- und Lebensformen der unterlegenen Kultur
werden verändert und zerstört.
8) Durch die neuen
Austauschbeziehungen zwischen Stadt und Land wird die Grundlage
und der Kern der andinen Kultur getroffen: die Gemeinschaft. Als
Folge werden Besitzverhältnisse stärker individuell
fixiert, kollektive Arbeitsformen verlieren an Bedeutung, die
sozialen Beziehungen, durch gegenseitige Verpflichtungen und
Rechte gekennzeichnet, werden durch eine fortschreitende
ökonomische und soziale Differenzierung geprägt. Die
Comunidad kann ihren Mitgliedern keine Sicherheit mehr geben und
auch nicht dem Ansturm äußerer Einflüsse
standhalten.
9) Das Verhältnis
zwischen Mensch und Kultur. Stand vorher das Gleichgewicht, der
Ausgleich zwischen Mensch und Natur im Vordergrund, wird nun die
Natur zum ausbeutbaren Material, was letztlich zur
Zerstörung der natürlichen Grundlagen
führt.
10) lndianische
Lebensformen erscheinen als rückständig, überholt
und vergangen. Selbst im mitleidig-helfenden Handeln
manifestieren sich vielfach Denken und Gefühle der
Überlegenheit - nicht nur der materiellen, sondern auch der
intellektuellen und moralischen - über die "Armen". Diese
Haltung schließt die Möglichkeit aus, sich auf den
anderen einzulassen und von ihm zu lernen.
11) Wenn lsolierung
der Kulturen keine Lösung ist, und jede Kultur und jede
Gesellschaft das Recht auf eine eigenständige Entwicklung
hat, erscheint das Lernen von anderen Kulturen die einzig
sinnvolle Perspektive zu sein.
Aus: F.G.
Kersting/U. Kersting "Indios" - Misereor/ "Pachacuti - Der Traum
einer neuen Welt/Hrsg. Arno Teutsch
 Urwälder der Erde
Urwälder der Erde
Menschen
kämpfen für ihre Rechte
Die Diskussionen
rund um den Tropenholzimport drehen sich vorwiegend um den Schutz
der Erdatmosphäre, Schutz der artenreichen tropischen Fauna
und Flora, drohende weltweite Klimaveränderungen,
Überbevölkerung und Verschuldung der
Entwicklungsländer. Meist wird bei solchen Diskussionen ein
wichtiger Punkt vergessen: Es wird den Menschen, die seit
Generationen in und von solchen Wäldern gelebt haben, zu
wenig Beachtung geschenkt.
Die sogenannten
borealen Wälder
Die Wälder in
Sibirien bedecken 5,9 Millionen Quadratkilometer, was 57% aller
Nadelwälder der Erde ausmacht. Es leben dort 26 verschiedene
indigene Völker mit einer geschätzten Einwohnerzahl von
1 Mio. Menschen. Die extremen Wetterbedingungen lassen die
Wälder nur langsam wachsen und das ökologische System
reagiert auf Störungen sehr empfindlich. Seit Mitte der 50er
Jahre werden die traditionellen Jagd- und Fischgründe der
Völker Sibiriens holzwirtschaftlich zerstört. 80% aller
geschlagene Hölzer stammen aus Kahlschlag, wobei 40% der so
gefällten Bäume nutzlos liegen bleiben. Die
Schäden sind enorm: lm Osten von Sibirien sind bereits 30%
der ehemaligen Waldfläche verschwunden. Seit der
Öffnung Rußlands drängen amerikanische,
japanische und südkoreanische Holzfirmen nach
Sibirien.
In Nordeuropa leben
rund 70.000 Sami (Lappen). Auch in den Sami-Gebieten wird
Kahlschlag betrieben. Es gibt Kahlschlaggebiete, wo sich auch
nach dreißig Jahren noch immer kein Wiederbewuchs
eingestellt hat. Die Wälder in schwedischen und finnischen
Sami-Land werden vor allem für die Papierindustrie
(Zellstoff-Produktion) gefällt, obwohl dieser lndustriezweig
unter Überkapazität und Verschuldung
leidet.
In der kanadischen
Provinz Saskatchewan kämpfen verschiedene Cree- und
Dene-Indianer zusammen mit sogenannten Metis (mixed-people) gegen
den Holzeinschlag in einem 33.000 Quadratkilometer großen
Waldgebiet am Meadow-Lake. Auch die Lubicon Cree-Indianer sind im
Bundesstaat Alberta bedroht: 1988 hatte die Provinzregierung eine
Waldfläche von 57.000 Quadratkilometer zum Kahlschlag
freigegeben. Die Konzession wurde an den japanischen
Zellstoffkonzern Daishowa verkauft.
Regenwälder
der gemäßigten Zonen
Nur 0,2% der
Erdoberfläche sind mit Regenwäldern der
gemäßigten Zone bedeckt. 3/4 des Bestandes findet sich
in Kanada und den USA, der Rest vorwiegend im Süden von
Australien, Neuseeland und Chile. Die Wälder im Süden
Chiles werden pro Jahr um rund 1.200 Quadratkilometer reduziert -
durch die Anlegung von Plantagen für Zellstoff (1993 an die
30.000 Quadratkilometer) und den Holzeinschlag für den
Export von Holzchips nach Japan. 86% der Flächen sind mit
der Monterey-Tanne und 7% mit exotischem Eukalyptus
bestockt.
An der
Pazifikküste in der kanadischen Provinz British Columbia
gibt es noch 100.000 Quadratkilometer Regenwald, davon stehen
allerdings nur 7.000 Quadratkilometer unter Schutz. Auch diese
kanadischen Regenwälder sind Heim für viele
lndianer-Völker, wo sie vor allem vom Fischfang und der Jagd
leben. Der Holzschlag führt zu Erosion, vertreibt die
Tierwelt und verschmutzt die Gewässer mit Pestiziden und mit
Abwässern der Zellulose-Fabriken. Pro Jahr werden in
British- Colombia 75 Millionen Qubikmeter Holz geschlagen,
mittels Kahlschlagpraxis. Einzelne Kahlschlagflächen
erreichen zusammenhängende Gebiete von 400 Quadratkilometer.
Der größte Teil des kanadischen Holzes wird
exportiert: 68% in die USA, 15% nach Europa und 9% nach Japan.
54% der gesamten kanadischen Zellstoff- Produktion wird nach
Europa exportiert, wo damit Papier hergestellt
wird.
Subtropische und
tropische Regenwälder
Eine große
Anzahl indigener Völker lebt im tropischen Regenwald am
Äquator und werden direkt oder indirekt durch die Folgen des
Holzeinschlags geschädigt.
In Brasilien wurden in
den Bundesstaaten Para´ und Acre zwischen 1985 und 1990
640.000 Kubikmeter Mahagoni-Hölzer geschlagen und
exportiert. Dazu mußten 3.000 km illegale Straßen
gebaut werden. Vor allem sind drei große lndianerreservate
mit einer Fläche von 33.800 Quadratkilometern betroffen. Pro
gefälltem Mahagoni rechnet man mit dreißig weiteren
zerstörten Bäumen, ganz zu schweigen vom plattgewalzten
Unterholz.
In Papua Neu Guinea
hat sich die malaysische ,,Rimbunan Hijau" bereits für 60%
der Wälder die Lizenzen gesichert. Seit 1992 hat sich der
Holzeinschlag in Papua Neu Guinea vervierfacht und "Rimbunan
Hijau" kontrolliert heute 86% des
Holzexportes.
Viele europäische
Holzfirmen sind in West- und Zentralafrika aktiv und
zerstören dort die Lebenswelt der Waldvölker. In
Zentralafrika sind bis zu 90% der Waldfläche als
Holzeinschlagsgebiete vorgesehen. Von den verschiedenen
Pygmäengruppen sind vor allem die Aka im Kongo und die Batwa
in Zaire betroffen. Der Holzeinschlag zerstört die
traditionelle Wirtschaftsweise der Jäger und Sammler und
deren Beziehungen zu den Bauernvölkern der Region, mit denen
sie seit Jahrhunderten in enger Wechselbeziehung
leben.
Aus: "Vielfalt";
GfbV-Schweiz, von Roger Graf
 Die
grüne Schatzkammer
Die
grüne Schatzkammer
Wie ein nur durch
die Weltmeere unterbrochenes grünes Band umspannt der
Regenwald die Erdkugel. Er erstreckt sich in Südamerika vom
Äquator aus jeweils 1 000 Kilometer nach Norden und nach
Süden und wird hier nur von Fiüssen zerteilt.
Fährt man den wasserreichsten aller Ströme, den
Amazonas flußabwärts Richtung Osten, durchquert man
das größte zusammenhängende Regenwaldgebiet der
Erde.
Das grüne Band
setzt sich von der Küste Afrikas entlang eines anderen
gigantischen Stroms, dem Zaire, fort bis zum indischen Ozean. Wir
finden Regenwälder wieder an der Westküste lndiens und
Sri Lankas, und er bedeckt in Südostasien Burma, Thailand
und das malaysisch-indonesische lnselreich und zieht sich weiter
östlich bis hin nach Neuguinea.
Es schließt sich
der weite Pazifische Ozean an, mit vielfäitigen
Regenwäldern, die über die lnselwelt des Pazifik
verteilt sind. Bis an die Ostküste Australiens erstrecken
sich noch heute die Ausläufer des
Dschungels.
Vor einigen
Jahrzehnten waren noch 16 Millionen Quadratkilometer der
Landoberfläche der Erde mit tropischem Regenwald bewachsen.
Vor allem in den letzten vierzig Jahren haben Menschen die
Hälfte davon abgeholzt oder verbrannt. Heute sind
schätzungsweise noch 8 Millionen Quadratkilometer
stehengeblieben, was etwa der Fläche der USA
entspricht.
Der Regenwald ist in
mehreren Schichten aufgebaut. Die höchsten Bäume ragen
bis zu 70 Metern in den Himmel. Das Dach Millionen Blätter,
verwoben zu einem schier endlosen Mosaik. Jedes einzelne Blatt
ist zur Sonne ausgerichtet. In 30 bis 50 Metern Höhe
befindet sich die Hauptmasse der Regenwaldpflanzen und ihrer
Bewohner. Zwei Drittel des Lebens im Regenwald spielt sich in
diesen Höhen ab.
Am Boden herrscht eine
ziemlich gieichmäßige Temperatur von etwa 28 Grad. Die
prasselnden Regengüsse der Tropen kommen als sanfter
Sprühregen in die unteren Regionen. Kein Wind bewegt hier
die schwüle, mit Feuchtigkeit gesättigte Luft. Auch
tagsüber ist es verhältnismäßig dunkel. Nur
ein bis zwei Prozent des Sonnenlichts können das dichte Dach
der oberen Pflanzenetagen durchdringen.
Kreislauf des
Waldes
lm Gegensatz zu den
Wäldern, die wir aus Mitteleuropa kennen, liegen auf den
Waldböden der Regenwälder wenig abgestorbene
Blätter. Pilze und Kleinstlebewesen zersetzen die
herabfallenden Pflanzenteile sofort und wandeln sie in
Nährstoffe um. Ohne diese Pilze, die beim Abbrennen des
Waldes zerstört werden, können die Urwaldpflanzen nicht
gedeihen. Durch das ständige Aufbereiten abgestorbener
Pflanzen ernährt der Wald seine Bewohner und bildet somit
ein weitgehend in sich geschlossenes System. Anders als in den
mitteleuropäischen Klimazonen birgt der Boden tropischer
Regenwälder oft nur sehr wenig Nährstoffe. Deswegen
sind die meisten Regenwaldgebiete für Ackerbau
ungeeignet.
75 Prozent der
Regenmenge, die über dem Wald niedergeht, verdunstet wieder.
Neue Wolken bilden sich. So wird ein Teil der Feuchtigkeit weiter
ins Landesinnere getragen, wo sie später als Regen
niedergeht.
Ökologische
Bedeutung
Obwohl die
Regenwälder lediglich den 16. Teil der Landesoberfläche
bedecken, speichern sie fast die Hälfte der weltweiten
Niederschläge. Welch einen großen Nutzen die
Regenwälder für das ökologische Gleichgewicht der
Region haben, spüren die Menschen oft erst, wenn die
Zerstörung schon weit fortschreitet. In lndien treten immer
verheerendere Überschwemmungen auf, weil die Wälder als
Wasserspeicher vernichtet wurden. In der sich
anschließenden Trockenperiode herrscht Mangel an
Trinkwasser und Dürre auf den Feldern. Die Regenwälder
der Elfenbeinküste, Ghanas und anderer westafrikanischer
Länder haben früher durch ständiges erneutes
Verdunsten der Niederschläge für ausreichend
Feuchtigkeit gesorgt, die von Winden Richtung Norden in die
Sahelzone getragen wurde. Nach der Abholzung dieser Wälder
kam es in der Sahelzone zu ungewöhnlichen
Dürrekatastrophen. Weltweite Hilfsaktionen wurden für
die vom Hungertod bedrohte Bevölkerung organisiert. Auf die
Idee, die Waldzerstörung zu stoppen, kam
niemand.
Für Brasilien
befürchtet sein bekanntester Umweltschützer, der
Wissenschaftler José Lutzenberger, daß eine
Zerstörung des östlichen Amazonas-Waldes zu einer
Austrocknung der gesamten Amazonas-Region führen
wird.
Artenreichtum
Man schätzt,
daß 50 bis 90 Prozent aller Tier- und Pflanzenarten in den
tropischen Regenwäldern existieren. Die meisten von ihnen
sind noch nicht einmal entdeckt, die allerwenigsten auch nur
ansatzweise erforscht. Die US National Academy of Sciences
schätzt, daß auf einem typischen Urwaldstück von
7 mal 7 Kilometern 1500 Arten Blütenpflanzen, 750 Baumarten,
125 Säugetier-, 400 Vogel-, 160 Kriechtier- und 150
Schmetterlingsarten vorkommen. 42 000 lnsekten pro Hektar
könnte man finden, würden entsprechende Forschungen
durchgeführt. Panama, gerade so groß wie Osterreich,
beherbergt mehr unterschiedliche Pflanzen als ganz Europa. lm
malaysischen Bundesstaat Sarawak auf Borneo gibt es 2500
einheimische Baumarten. In Amazonien lebt ein Fünftel der
weltweit bekannten 9000 Vogelarten, zehnmal mehr als in
Europa.
Die einzelnen Arten
kommen jedoch nicht häufig vor. Auf 15 Hektar im
malaysischen Regenwald fanden sich 381 verschiedene Baumarten,
davon waren 157 jeweils nur mit einem einzigen Exemplar
vertreten. Viele der Arten sind endemisch, das heißt, sie
sind nur in einem begrenzten Gebiet beheimatet.
Komplexität
Am ehesten werden die
komplexen Zusammenhänge noch bei Pflanzen erforscht, die der
Mensch für sich nutzen möchte. Nicht selten stellt sich
dabei heraus, daß man Regenwaldpflanzen nicht einfach aus
ihrem Zusammenhang reißen und in Monokulturen anbauen kann.
Paranüsse etwa werden ausschließlich im Wald von
wildwachsenden Paranußbäumen geerntet. Vor einigen
Jahren versuchte man, die Paranuß in Plantagen anzubauen.
Die Bäume blühten, trugen aber keine Früchte. Man
fand heraus, daß der Paranußbaum von einer Bienenart
bestäubt wird, die wiederum für ihren Fortbestand eine
bestimmte Chemikalie benötigt. Diese Chemikalie
schlürft die Biene aus einer wild wachsenden Orchideenart,
die nur im Regenwald vorkommt. Zusätzlich ist der
Paranußbaum bei der Arterhaltung auf das Agouti angewiesen.
Nur dieses Nagetier kann mit seinen scharfen Zähnen die
harten Schalen der Paranuß knacken und die Nüsse
großflächig verteilen.
Aus: "Raubmord
am Regenwald - Vom Kampf gegen das Sterben der Erde" von Behrend,
Reinhard/Paczian aus "Unterrichtseinheit Yanomami im
Amazonas-Regenwald" der GfbV-Deutschland
 Die Indianer
Südamerikas
Die Indianer
Südamerikas
Das Wort ,,Indio"
hat in einigen Ländern Südamerikas einen ähnlichen
Beigeschmack erhalten wie die Bezeichnung "Nigger" für
Schwarze. Zum Beispiel in Guatemala ist die Bezeichnung "Indio"
ein Schimpfwort. Jahrhundertelang drückten die
europäischen Eroberer damit ihre Geringschätzung
gegenüber den lndianern aus. Respektvoller ist das Wort
,,indigena" (Einheimischer).
Grundsätzlich
muß unterschieden werden zwischen Hochlandindianern - den
Nachkommen der alten Hochkulturen des Andengebietes - und
Tieflandindianern, die sich in eine Vielzahl von voneinander
unabhängigen Volksgruppen gliedern und vornehmlich im
Amazonasbecken leben.
Die indianische
Bevölkerung Südamerikas hat zwar viele Gemeinsamkeiten,
aber genauso viele Unterschiedlichkeiten. Man schätzt die
Zahl der lndianersprachen auf über 500: Sie sind zum Teil so
unterschiedlich wie Deutsch und Chinesisch. Manche Sprachen, wie
das Quechua der Aymara der Andenländer, werden von ein paar
Millionen Menschen gesprochen, andere nur von einigen wenigen
Personen, wie z.B. das Zaparo im Urwaldgebiet von
Ecuador.
Die Zahl der
Tieflandindianer wird auf eine Million geschätzt. Das ist
sehr wenig, wenn man bedenkt, daß das Siedlungsgebiet der
Ureinwohner die riesigen Areale von der karibischen Küste
über die Urwälder des Orinoco und Amazonas bis hin zum
Gran Chaco in Paraguay umfaßt. Allein das Amazonasbecken
hat eine Längsausdehnung, die der Entfernung von Lissabon
bis zum Ural entspricht.
Nach 500 Jahren
kolonialer oder nationaler Beherrschung haben aber nur wenige
Stammesgruppen durch Anpassung oder Rückzug der kulturellen
Zerstörung entgehen können. Heute kämpfen die
indianischen Völker darum, ihre kulturelle und ethnische
ldentität bewahren zu können. Die lndianer, die das
kulturelle Erbe bewahrten, haben mit ihren Naturkenntnissen und
botanischen Entdeckungen einen wertvollen Beitrag zum kulturellen
Reichtum der Menschheit geleistet und können ihn weiter
leisten, wenn es gelingt, ihre Bedeutung zu erkennen und sie zu
bewahren.
Die gesellschaftlichen
Prinzipien, die auf Partnerschaft statt auf Privilegien beruhen,
und die Einstellung zur Natur, die sie nicht zerstört haben,
sondern mit der sie leben, könnten Anregungen zum
Überdenken der Lebensweisen der modernen
Industriegesellschaft geben.
Aus:
GfbV-Unterrichtseinheit "Mit den Wäldern sterben die
Menschen" von Siegfried Wevering
 Die
Yanomami
Die
Yanomami
Die Yanomami
bewohnen ein Gebiet, das etwa der Größe von
Österreich entspricht. In Venezuela liegt ihr Siedlungsraum
am oberen Orinoco und im Bereich der Flüsse Mavaca, Ocamo,
Putaco und Siapa. Die 1.000 Meter hohe Sierra Parima, die
Wasserscheide zwischen Orinoco und Amazonas, bildet die
Staatsgrenze zwischen Venezuela und Brasilien und gilt als das
Kernland der Yanomami. Auf brasilianischem Territorium
umfaßt ihr Verbreitungsgebiet die Flüsse Uraricuera,
Catrimani und Dimini.
Die Yanomami, deren
Name in ihrer Sprache ,,Mensch" bedeutet, gliedern sich in
verschiedene Untergruppen: Schamatari, Waika, Sanema´,
Schirischana und Guajahbo. Man schätzt ihre Zahi in
Venezuela auf 15.000 und in Brasilien auf etwa 9.000 Menschen.
Die meisten Wissenschaftler nehmen an, daß ihre Sprache
isoliert, d.h. mit keiner anderen verwandt ist.
Die
Shabono-Gemeinschaft
Die Yanomami leben in
über 350 kleinen, weit verstreuten Dörfern, die
völlig autark sind. Sie bilden Großfamilien von 30 -
100 Mitgliedern, die jeweils eine Maloca - ein langes,
großes Rundhaus - teilen; für dieses Rundhaus ist auch
der Begriff Shapono oder Shabono gebräuchlich. Seine
Bauweise spiegelt gleichzeitig die Weltordnung der Yanomami
wider. Dieses Gemeinschaftshaus ist das Zentrum ihrer Welt. Von
hier aus gehen die Yanomami auf die Jagd, sammeln
Wildfrüchte und pflanzen in der Umgebung verschiedene
Nutzpflanzen in Gärten an.
Kleidung und
Körperschmuck
Die Kleidung der
Männer besteht aus einer Schnur, die um die Hüften
gebunden und mit der der Penis an der Vorhaut hochgebunden wird.
Bei festlichen Anlässen tragen sie an den Schultern und
Oberarmen prächtigen Federschmuck. Die Frauen sind nackt und
tragen eine Schnur um die Taille, die zum Befestigen von
verschiedenen kleinen Gegenständen dient. Durch die
perforierten Ohren und das Nasenseptum stecken sie Blumen bzw.
feine Stäbchen.
Nahrung
Die
Grundnahrungsmittel (Kochbananen und Cassava) werden wegen ihres
schnellen Wachstums (und wegen ihrer Eigenschaft, auch auf
nährstoffarmen Böden gut zu gedeihen) geschätzt.
Die stickstoffarmen Böden eignen sich nur schlecht für
aufwendige Anbauprodukte wie z.B. Mais; aufgrund der schwachen
Erträge ist ein Anbau kaum mehr als einmal pro Parzelle
möglich. Die Grundnahrungsmittel decken also den
täglichen Bedarf an Protein, essentiellen Fetten und
Vitaminen nur unzulänglich und bieten keine ausgewogene
Ernährung, obwohl es sich um energiereiche Nahrungsmittel
handelt. Um eine ausgewogene Ernährung zu garantieren,
suchen die lndianer ihren Speisezettel durch Früchte,
Wildbret, Fisch und kleinere Tiere, die im Regenwald gesammelt
werden, zu ergänzen. Durch diese Kombination der Nahrung,
die Wald und Gärten bereitstellen, sind die Yanomami in der
Lage, sich mit einem Minimum an Aufwand gesund zu
ernähren.
Sammeltätigkeiten
Früchte, Knollen
und wilder Honig aus dem Wald, eßbare lnsekten (Larven),
Krabben, Frösche und andere kleine Tiere stellen eine
wichtige Bereicherung der Ernährung der Yanomami
dar.
Fischfang und
Jagd
Die Yanomami verstehen
sich darauf, Tümpel oder kleinere Flußläufe mit
dem Saft von Lianen zu vergiften. Der Saft, der ein mildes
Nervengift enthält, lähmt die Kiemenatmung der Fische,
so daß sie mit Handnetzen gefangen werden können. Die
Jagd wird auf traditionelle Weise mit Pfeil und Bogen
durchgeführt. Gejagt werden Affen, eine Vielzahl von
Vögeln, Gürteltiere, Tapire, Krokodile
etc.
Der
Brandrodungswanderfeldbau
Zu Beginn der
Trockenzeit roden die Yanomami den Wald. Das Unterholz wird
gerodet; anschließend werden die größeren
Bäume gefällt. Die geschlagenen Bäume werden
liegengelassen, und das Holz trocknet aus. Einige Monate nach der
Rodung wird dann das Holz verbrannt. Durch das Abbrennen wird die
gesamte Pflanzendecke in Nährstoffe (Asche) umgewandelt, die
dann durch den Regen in den Boden gelangen. Außerdem werden
durch das Abbrennen Samen und Sämlinge im Boden
abgetötet; dadurch dauert es einige Zeit, bis sich das
Unkraut wieder ausdehnen kann.
Der Regen wäscht
die Nährstoffe aus der ausgebrannten Biomasse sehr schnell
in den Boden aus. Um den Nährstoffreichtum zu nutzen,
beginnen die Yanonami mit ihren Pflanzungen sofort nach Einsetzen
der Regenzeit. Die Saat reift schnell. Bereits nach vier Monaten
kann der Mais geerntet werden.
Die Pflanzungen
müssen in der Wachstumsphase von Unkraut freigehalten
werden, denn die Rückeroberung des Waldes droht von allen
Seiten. Trotzdem wuchert Unkraut immer wieder durch und nach
ungefähr drei Jahren wird das Jäten zu aufwendig; die
Pflanzungen werden aufgegeben und neue werden
angelegt.
Nach ca. 50 Jahren
sehen die ehemaligen Gärten schon wieder wie Regenwald aus,
obwohl es bis zu 100 Jahren dauern kann, bis das ganze Spektrum
von Fauna und Flora sich regeneriert hat. Einmal genutzte
Pflanzungen werden in der Regel nicht wieder urbar gemacht,
zumindest nicht innerhalb der ersten 50 Jahre.
Gesellschaftsleben
Die Yanomami haben
einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und
Gleichheit. Ungleichheit im persönlichen Hab und Gut oder im
Ansehen und Status in der Stammesgruppe sind minimal. lhre
Gesellschaft funktioniert ohne zentralisierte Machtstrukturen
oder öffentliche Autoritäten, die mit Machtbefugnissen
gegen andere versehen sind. Bei den Yanomami gibt es keinen
,,Häuptling", obgleich Verwandtschaftsgruppen ihre
lnteressen durch Sprecher kundtun, die dann bei Konflikten als
Führer handeln.
Kleinere
Meinungsverschiedenheiten werden problemlos toleriert - bei
schwerwiegenden Differenzen kann sich ein Teil des Dorfes trennen
und zeitweise wegziehen. lm Sozialleben der Yanomami fällt
die starke Betonung der Unabhängigkeit, der Rechte, aber
auch der Pflichten des lndividuums auf.
Religion,
spirituelle Kultur. Die Schamanen
Bewahrer der
Stammestradition sind die Schamanen, die durch Einnahme von
Drogen in andere Welten vordringen können, welche
gewöhnlichen Sterblichen verschlossen sind. Diese
Spezialisten heißen bei den Yanomami schaboliwa und
können nur Männer sein. Die bekannteste Droge ist unter
dem Namen yopo oder ebena bekannt. Die Schamanen konsumieren
große Mengen von ebena, das sich jeweils zwei Männer
mittels eines langen, knotenfreien Rohres gegenseitig in kleinen
Dosen in die Nasenlöcher blasen. Nachdem sich verschiedene
Visionen eingestellt haben, beginnen die Schamanen mit erhobenen
Armen zu tänzeln und stimmen dabei einen melodischen Gesang
an. Damit rufen sie die Hilfsgeister an, die in ihrer Brust Platz
nehmen. Andere knien auf dem Boden und imitieren die mythischen
Tiere, in die sie sich verwandeln. Nur im Trancezustand ist es
dem schaboliwa möglich, die kosmischen Bereiche zu
durcheilen, die Dorfgemeinschaft vor Gefahren zu bewahren und die
Ursachen von Krankheiten zu erkennen und zu
heilen.
Die wichtigste
Therapie eines Schamanen besteht darin, die als materielle
Substanz gedachte Krankheit aus dem Körper des Patienten zu
saugen. Die wichtigste Aufgabe des Schamanen besteht also in der
Heilung von Krankheiten, bei der gewissermaßen die Urformen
medizinischer Techniken Anwendung finden.
Das
Totenritual
Von größter
Bedeutung für die Yanomami sind die magischen
Zusammenkünfte anläßlich der Abhaltung von
Totenfeiern. Wenn ein Yanomami stirbt, wird sein Leichnam
verbrannt. Die Knochenreste werden zu einem Pulver zerstampft und
in einer Kalebasse aufbewahrt. Einmal jährlich finden die
Totenfeierlichkeiten statt, bei denen diese Überreste des
Verstorbenen mit einem Bananenbrei vermengt und von den
Familienmitgliedern getrunken werden. Dadurch wird nach den
Vorstellungen der Yanomami die Totenseele frei und kann ins
Jenseits eingehen.
Wir lndianer
sind keine Tiere
Wir sind
friedliebende Menschen,
wie ich hier in
diesen Versen zeige.
Wir greifen nur an,
wenn wir angegriffen werden, und dann sind wir
wütend.
Wir empfingen die
Lusitaner*,
die hier angekommen
sind.
Wir bekamen ihre
Geschenke.
Wir gaben andere
dafür.
Der Weiße war
zufrieden.
Wir wurden
geschlagen und ausgebeutet,
auch
versklavt.
Man nahm uns Frau
und Land.
Wir widersetzten
uns - wir flohen
zum Urwald und in
die Berge.
Wir bewaffneten uns
so gut es ging,
um dem Krieg zu
begegnen.
Jetzt nach fast
fünfhundert Jahren
merkt die
Gesellschaft nicht,
daß wir
lndianer weiterhin,
ohne jede
Gerechtigkeit,
ausgebeutet
werden.
Und die, die weit
geflohen
und übrig
geblieben sind,
werden von neuen
Straßen gestört,
sogar in den
entlegensten Winkeln,
auch von
Goldgräbern und Farmern
und durch neue
Konflikte.
*
Portugiesen
von Maxado
(Brasilien), Quelle: Kalender 1992 der Gesellschaft für
bedrohte Völker
 Die
Kolonialisierung des Amazonasgebiets
Die
Kolonialisierung des Amazonasgebiets
Das Eindringen der
Weißen ins Amazonasgebiet erfolgte nicht erst im 20.
Jahrhundert, sondern setzte viel früher ein. Die erste Phase
dieser Eroberung ist gekennzeichnet durch:
- Gründung von
Missionsstationen, an denen man die indianische Bevölkerung
zu konzentrieren versuchte Anlage von Forts mit angeschlossenen
Siedlungen (Belém 1616, Manaus 1669, Boa Vista 1740
u.a.)
- Eindringen von
Gold- und Diamantensuchern; insbesondere die Ausbeutung der
Goldminen von Mato Grosso im 18. Jahrhundert.
Die großen
Stämme am Amazonas widersetzten sich dem Vordringen der
Weißen. Die Munduruku` und Mauhé zum Beispiel, zwei
Stämme, deren Kopfzahl im 18. Jh. auf 40.000 bzw. 20.000
geschätzt wurde, griffen die Städte an. 1795 schlossen
die Munduku` mit den Portugiesen Frieden und unternahmen nun
ihrerseits Kriegszüge und Sklavenjagden auf indianische
Stämme, die den Weißen feindlich
gegenüberstanden, bis dann im 19. Jh. eine intensive
Missionierung einsetzte. Die Mura, einst ebenfalls ein
großer Stamm, gingen ein Bündnis mit
aufständischen Brasilianern ein, deren Aufstand 1836 blutig
niedergeschlagen wurde. Strafexpeditionen und Krankheiten
führten danach zu einer drastischen Dezimierung der Mura und
der größte Teil der Überlebenden verschmolz
später mit der brasilianischen
Landbevölkerung.
Der
Kautschukboom
Schon 1827 wurde von
Belém aus Rohgummi verschifft. Aber erst die Erfindung des
Vulkanisierungsprozesses durch Goodyear (1839) führte zu
neuen Verwendungsmöglichkeiten des Kautschuk und zu einem
enormen Anstieg der Produktion. Brasilien besaß das Monopol
auf Naturgummi bis 1900, als der billigere Plantagenkautschuk
Englands auf den Weitmarkt kam. 1942-47 erlebte die
brasilianische Kautschukwirtschaft noch einmal einen Aufschwung,
ausgelöst durch den Kriegseintritt der USA. Durch die
japanische Eroberung der malaiischen Halbinsel waren die
Amerikaner von ihrer wichtigsten Rohgummiquelle abgeschnitten
worden.
Während der
Kautschukboom den Handelshäusern in Manaus und Belém
ein Wirtschaftswunder bescherte, etablierte sich in den
Wändern ein brutales System der Ausbeutung weißer und
indianischer Arbeitskräfte. Der Patron ist Pächter der
Kautschukbäume, die entlang einer bestimmten
Flußstrecke stehen. Er wirbt durch Vorschuß eine
Anzahl Männer an und läßt sie zu ihrem
Bestimmungsort, der Feitoria, bringen. In der Feitoria leben die
brasilianischen Sammler in der Regel ohne Familie, sie sind
chronisch unterernährt und leiden häufig an
Krankheiten. Obgleich die große Nachfrage seit 1912
ausblieb, wird in geringerem Umfang bis heute Kautschuk
gesammelt. Seit einigen Jahren bemüht sich die Regierung
wieder um eine lntensivierung der Kautschukwirtschaft in
Nordwest-Amazonien (Bundesstaat Acre, entlang des Rio Jurua und
Rio Purus, Gebiet der Flüsse lcana, Vaupés und
Japurà) und im Mato Grosso und Rondonia (oberer Madeira,
Jiparanà, Guaporé und Nebenflüsse, oberer
Tapajos und vor allem dessen Zuflüsse Juruena und Teles
Pires.
Kautschukwirtschaft und
lndianer
Zur Zeit des
Kautschukbooms wurden lndianer versklavt und zur Arbeit im
Seringal (Kautschukwald) gezwungen bzw. getötet, wenn sie
Widerstand leisteten. Aber auch in der folgenden Zeit versuchten
die Patrone, die lndianer an die Nähe der Rohgummidepots zu
binden und sie in Schuldknechtschaft zu halten. Einmal an die
Waren der Weißen gewöhnt, fiel es den lndianern
schwer, auf sie zu verzichten und wieder ein traditionelles Leben
aufzunehmen. Zahlreiche Epidemien, ausgelöst durch Kontakte
mit den Gummisammlern, dezimierten manche Gruppen so stark,
daß es den Überlebenden oft unmöglich war,
unabhängig zu bleiben. Für die meisten Gummisammler
waren die lndianer Wilde, die ihre Arbeit behinderten oder
bedrohten.
Für die Zeit um
1950 ergab sich in bezug auf die indianische Bevölkerung des
Amazonasgebietes folgendes Bild: Viele Stämme existierten
nicht mehr. Alle, die mit Weißen in Berührung gekommen
waren, waren durch Krankheiten erheblich dezimiert worden. Viele
Stämme - oder besser gesagt Reste von Stammesgruppen -
standen in ständigem Kontakt mit Weißen. Viele standen
unter Missionseinfluß. lhre traditionelle Lebensweise hatte
sich verändert. Zahlreiche Stämme, unter ihnen auch
jene, die vor den Weißen geflohen waren, lebten im lnnern
des Landes, das weitgehend unerschlossen war.
Nach einer Zeit
relativen Ruhe zwischen 1912 und 1950 brach dann in der 50er
Jahren und besonders mit dem Einsetzen der staatlichen
Entwicklungsplanung ab 1966 eine neue Phase der inneren
Kolonisierung des Amazonasgebietes an. Die neue Entwicklungsphase
begann mit dem Bau von Straßen, die auch bisher
unzugängliche Gebiete erschlossen. Die staatliche
Entwicklungsplanung sah eine großflächige Nutzung des
Landes unter Einsatz von Großkapital und -technologie vor.
Für die Indianer bedeutete dies, daß ihr Land von
Weißen beansprucht wurde und ihnen keine Möglichkeit
mehr blieb, in andere Gebiete auszuweichen.
1966 - Beginn
der Operation Amazonien
" ... Nichts wird uns
in diesem Bestreben aufhalten, das die höchste Aufgabe der
zivilisierten Menschheit im 20. Jahrhundert darstellt: die
Eroberung und Beherrschung dieses großen Stromtales am
Äquator, um seine wilde Kraft und seine
außergewöhnliche Fruchtbarkeit in gezähmte
Energie zu verwandeln. Durch unseren Willen und unsere Arbeit
wird der Amazonas nicht länger ein unbedeutender Bestandteil
der Weltgeschichte bleiben, sondern - ebenso wie andere
große Flüsse - zu einem Kapitel in der Geschichte der
Zivilisation werden ... "
Diese Worte sprach der
damalige Präsident Vargas, als er 1940 in Manaus seinen
,,Discurso do Rio Amazonas" hielt. In den 60er Jahren wurde die
lntegration des Amazonasgebietes in die gesamtbrasilianische
Wirtschaft zunehmend diskutiert. Dabei spielte u.a. die Angst vor
einer ausländischen Dominierung eine
Rolle:
Der englische
Ökonom Boulding hatte 1963 den Vorschlag gemacht, die
Überbevölkerung in unterentwickelten Ländern durch
eine Umsiedlung ins Amazonasgebiet und andere "Leerräume"
der Erde" abzubauen.
Zur selben Zeit
tätigten Amerikaner große Landkäufe, nachdem die
US-Air-Force eine Studie über das Amazonasgebiet erstellt
hatte, in die als erste lndustrielle Einblick erhalten hatten. So
erwarben z.B. Rockefeller 500.000 ha, der Holzkonzern Georgia
Pacific 400.000 ha und Keith Ludwig über die National Buik
Carriers 1,4 Mio. ha am Rio Jari im Bundesstaat
Parà.
1966 verkündete
die brasilianische Regierung die ,,Operation Amazonien". Die
ersten Straßen wurden gebaut (Manaus-Boa
Vista/Cuiaba-Pórto Velho).
"Land ohne
Menschen für Menschen ohne Land". Ansiedlung von Kleinbauern
im Amazonasgebiet
1970 ereignete sich
eine der größten Dürren des Jahrhunderts im
Nordosten, dem Gebiet, das durch Großgrundbesitz,
Bevölkerungswachstum und Trockenheit zum Armenhaus
Brasiliens geworden ist. Die ausbrechende Hungersnot führte
zu Unruhen und Aufständen. Für die Regierung war damit
der Anlaß gekommen, die Erschließung des
Amazonasgebietes in Angriff zu nehmen. Entlang neuer
Fernstraßen sollten Kleinbauern aus dem Nordosten
angesiedelt werden.
Noch im gleichen Jahr
(September 1970) wurde mit dem Bau der Transamazonica und der
Straße BR-163 (Cuiaba-Santarém) begonnen. Mit
großem Aufwand wurde für die Besiedlung des ,,Landes
ohne Menschen für Menschen ohne Land" geworben, die
innerhalb von 10 Jahren eine Million Familien ins Amazonasgebiet
bringen sollte.
Man hatte nicht
berücksichtigt, daß große Teile des
Amazonasgebietes wenig fruchtbar sind und sich nicht für
eine intensive Landwirtschaft eignen. Die Pla ner sprachen jetzt
nur noch von 100.000 Familien, und die Besiedlung wurde auf
ausgewählte Straßenabschnitte mit etwas fruchtbareren
Böden eingeschränkt.
Bis Ende 1974 waren
etwa 6.500 Familien an der Transamazonica angesiedelt worden, von
denen noch nicht einmal 113 aus dem Nordosten stammte. Die
Anwerbung wurde schon 1973 eingestellt, und die staatliche
Kleinbauernansiedlung konnte danach als gescheitert gelten.
Seitdem drängt ein Strom von Posseiros (Landlosen) auf der
Suche nach Neuland weiter in indianische Gebiete vor. Besonders
betroffen waren die Bundesstaaten Ceara´, Pernambuco und
Rio Grande do Norte
Der erzwungene
Wandel
Die Konfrontation der
lndianer mit den Weißen erfolgte so abrupt und brachte so
einschneidende Veränderungen mit sich, daß kein Stamm
die Möglichkeit hatte, sich allmählich auf die
Veränderungen einzustellen oder gar eigene Entscheidungen zu
treffen. Der psychische Schock und die Hoffnungslosigkeit fanden
ihren beklemmendsten Ausdruck in der Reproduktionsverweigerung
(Fortpflanzungsverweigerung): Frauen weigerten sich, ihre
neugeborenen Kinder aufzuziehen und töteten sie oder wurden
steril. Die Krankheiten, die jede Gruppe drastisch reduzierten
und die permanenten Störungen durch Straßenbau,
Rodungen usw. führten dazu, daß die lndianer sich
nicht mehr ausreichend um ihre Pflanzungen kümmern konnten.
Der Wildbestand ging zurück, weil Straßenbauer sowie
Siedler und Farmarbeiter die Gegend leerschossen oder das Wild
vertrieben.
Die
Überlegenheit, die die Weißen durch ihre materiellen
Güter demonstrierten, führte gleichzeitig zu einer
Abwertung der sozialen und geistigen Kultur der lndianer. Die
lndianer verzichteten auf Stammeszeichen, wurden häufig dazu
angehalten, ihre Gemeinschaftshäuser zugunsten von
Kleinfamilienhütten aufzugeben, traditionelle Bräuche
wurden lächerlich gemacht, das Schamanentum entwertet,
Häuptlinge entgegen der traditionellen Struktur protegiert.
Alles in der Absicht, das indianische Gruppenbewußtsein und
die Mechanismen zur sozialen Kontrolle zugunsten einer
individualistischen Lebensweise nach westlichem Muster
außer Kraft zu setzen.
Goldrausch im
Regenwald. Die Hoffnungen der Ärmsten bleiben
unerfüllt
(...) Schwitzend
schleppt José Raimundo de Jesus den Sack mit Steinen nach
oben an den Kraterrand. Eine Tonne Abraum schafft er täglich
aus der Tiefe. Tausend nackte, schlammverschmierte Männer
wühlen wie besessen neben ihm im Dreck. Von der Goldgrube in
Amazonien bis zum Haupttresor der Bank in der fernen Schweiz
führt ein langer, unwegsamer Pfad. Er beginnt bei den
formígas, den menschlichen Ameisen, die das rote Metall
suchen, und endet bei den Dunkelmännern, die es
horten.
Mehr als zwei
Millionen Menschen schürfen, kratzen, hacken und graben in
Brasilien nach Gold. Als man vor zehn Jahren in der Sierra Pelada
faustgroße Brocken des Edelmetalls fand, brach der
Goldrausch in Amazonien aus. (...) Zu den Eldorados im Regenwald
kommen alle, die nichts mehr zu verlieren haben. Heerscharen
hungernder Landarbeiter, das Lumpenproletariat aus den Favelas,
Strandgut der Gesellschaft und das fahrende Volk ziehen nach
Westen und Norden. Städte aus Bretterbuden wachsen wie
Krebsgeschwüre, Brände fressen sich in den Regenwald.
Hemmungslos wird niedergemacht, was im Wege steht. Das
Millionenheer der garimpeiros reißt die Erde auf und
durchwühlt sie, gräbt Flüsse ab und füllt sie
mit Müll, brennt, brandschatzt und mordet und
hinterläßt eine einzige Wüste. An den
Rändern der Staubpisten und Schlammwege bleiben die
Erschöpften zurück, die Kranken, Frauen und Kinder. Die
Männer ziehen weiter auf der stetigen Suche nach
Gold.
(...)
Die,,Facharbeiter", die mit Hacke und Schaufel die Goldadern
aufbrechen oder mit scharfem Wasserstrahl das Geröll
aufschwemmen, erhalten eine Gewinnbeteiligung, ebenso wie der
Aufseher, der am Rand der Grube die Liste führt. Der
Löwenanteil geht aber an Besitzer oder Aktionäre der
Grube.
(...) Drei Viertel der
brasilianischen Goldförderung werden am Fiskus und am Zoll
vorbei ins Ausland geschmuggelt. ( ...) lm Gegensatz zu Sibirien
und Südafrika wird das Edelmetall in Amazonien nicht mit
Baggern und Bulldozern herausgeholt, sondern mit Hacke und
Schaufel. Mit besserem Gerät könnte man mehr und
schonender Gold in Brasilien fördern, meinen die Manager des
staatlichen Minenkonzerns Vale do Rio Doce. (...) Ein
mechanisierter Abbau der Goldlager käme wegen der besseren
ökologischen und fiskalischen Kontrolle vielleicht dem Wald
und dem Staat zugute, aber kaum den vielen Geschäftemachern,
die am Goldschmuggel verdienen.
Vor allem aber - was
geschähe mit den garimpeiros und ihren Familien? Wo bliebe
die Hoffnung dieser Millionen auf das große Glück?
,,Das Amazonasgebiet ist Brasiliens soziale Abfallgrube",
schimpft ein Redakteur der Lokalzeitung in Maraba. Abfallgrube -
aber auch soziales Ventil: Solange in Amazonien eine bessere
Zukunft winkt, gibt es wenig Grund zur Rebellion gegen die Armut
auf dem Lande und das Elend in den
Städten.
Aus:
GfbV-Unterrichtseinheit "Der hohe Preis des Goldes: Den
Yanomami-Indianern im Amazonas-Regenwald droht der Untergang" -
Die Zeit (3.11.8) von Carl D. Goerdeler
 Goldsucherinvasion in Malaria
Goldsucherinvasion in Malaria
Der schleichende
Genozid an Brasiliens lndianern
(...) Die
inzwischen über 80.000 Garimpeiros im Stammesgebiet der rund
15.000 Yanomami sind fast durchwegs bitterarme,
unterernährte Analphabeten aus Brasiliens unterentwickelten
Nordostregionen (...). Als das Schürfgebiet eröffnet
wurde, gab es in den Wäldern noch Wild und Vögel sowie
Fische in den Bächen. Die ausgehungerten Garimpeiros haben
jedoch alles abgeschossen (...). Schmerzlicher als die Yanomami,
welche jahrhundertelang Bestandteil einer völlig intakten
Natur, eines funktionierenden Ökosystems waren, kann niemand
die ungehemmte, sinnlose Zerstörung empfinden. Ein Mitglied
des Stammes, Davi Yanomami, spürt jedoch nicht nur Schmerz
und Verzweiflung - er steht unter psychischem Druck besonderer
Art. 1989 überreichten ihm UN-Vertreter den Umweltpreis
"Global 500" (...).
Der Yanomami
erhält ständig Morddrohungen der Goldmafia und ist
bereits einigen Hinterhalten entronnen. Davi ist Mitarbeiter der
staatlichen lndianerschutzbehörde FUNAI und muß mit
ansehen, daß nicht nur diese, sondern auch Polizei und
Militär, sämtliche Behörden des Teilstaates
Roraima und sogar die Regierung in Brasilia Gesetze und sogar
Verfassungsartikel offen mißachten, die den Lebensraum, die
Kultur und die Lebensweise der letzten etwa 250 000 von einst
fünf Millionen brasilianischen lndianern garantieren sollen.
Theoretisch dürfte sich kein einziger Garimpeiro im
Yanomami-Gebiet aufhalten; die FUNAI hätte mit
Unterstützung von Polizei und Militär verhindern
müssen, daß (das Schürfgebiet) Malaria und
sämtliche anderen ungezählten Schürfgebiete
überhaupt installiert werden. Davi sagte, daß nur
seine Bekanntheit ihn vor Sanktionen und auch vor der Entlassung
durch die FUNAI schützt, die sich auch in Roraima
häufig von motivierten und deshalb unbequemen Mitarbeitern
getrennt hat. ,,Vier meiner Verwandten sind von Garimpeiros
erschossen worden, immer mehr lndios sterben jetzt, durch
Krankheiten und durch Schüsse. Wir haben nichts mehr zu
jagen und leiden Hunger. Oft werden lndianerinnen von Garimpeiros
vergewaltigt. Auch die in den Waldgebieten stationierten
Militärpolizisten tun das. Sie bringen Schnaps mit, und wenn
sie auf lndiodörfer treffen, geben sie den nichtsahnenden
Männern Schnaps. Und wenn diese dann betrunken sind, fallen
sie über die Frauen her. Die FUNAI sagt, alles ist gut, alle
sind gesund, alle leben in Frieden. Aber es stimmt nicht, es ist
eine Lüge."
Die Zusammensetzung
des FUNAI-Personals von Roraima läßt nationalen und
ausländischen Sympathisanten der lndianer die Haare zu Berge
stehen. Abgesehen von Davi ist niemand kompetent; selbst
ehemalige Chauffeure und Hilfsarbeiter sollen zur
,,Indianerbetreuung" eingesetzt werden. Der Chefadministrator,
der Agronom Raimundu Nonato da Silva, besaß das Vertrauen
des Nationalen Sicherheitsrates bereits während der
Diktaturzeit - damals wurde er zum Bürgermeister einer Stadt
in einer militärischen Sicherheitszone ernannt. Sein
Parteifreund von der konservativen Liberalen Front, Romero
Juca´, wurde just in dem Moment letztes Jahr vom nationalen
FUNAI-Präsidenten zum Gouverneur von Roraima befördert,
als die Zeitungen fast täglich über seine Verwicklung
in illegale Geschäfte schrieben - unter anderem mit
Holzunternehmen, die lndianerwald rodeten. Der ehemalige
Präsident der FUNAI, Chagas, betont, keinerlei Kenntnis von
Konflikten in den Schürfgebieten, von sterbenden oder
kranken lndios zu haben-, die FUNAI habe genügend
lmpfaktionen durchgeführt. Maßnahmen gegen die
Garimpeiro- lnvasion hält er für nicht
realisierbar.
Aus:
GfbV-Unterrichtseinheit "Der hohe Preis des Goldes: Den Yanomami
im Amazonas-Regenwald droht der Untergang" von Klaus Hart
"Goldsucherinvasion in Malaria", NZZ
15.4.89
 Die
Indianerpolitik Brasiliens
Die
Indianerpolitik Brasiliens
Die Besiedlung
Brasiliens ist von Anfang an durch die Okkupation indianischen
Landes und die Ausrottung und Vertreibung seiner Bevölkerung
gekennzeichnet gewesen. Von 1500 bis heute sind 90% der lndianer
von der Bildfläche verschwunden. lhr Anteil an der
brasilianischen Bevöfkerung beträgt heute
0,2%.
lm 20. Jahrhundert kam
es zur Gründung von lndianerschutzorganisationen, und zwar
zu Zeiten besonders brutaler Gewalttätigkeiten an lndianern.
Als der Direktor des Museu Paulista, Hermann von Hering, die
Ausrottung aller feindlichen lndianer postulierte, kam eine
heftige Debatte in Gang und 1910 gründete Rondon den SPI.
Die Organisation sah ihre Hauptaufgabe darin, friedliche Kontakte
zu den lndianern aufzunehmen, unter der Devise "Sterben wenn
nötig, töten nie". Rondon ging davon aus, daß
sich die lndianer unter dem Schutz des Staates und unter Garantie
ihres Landes allmählich zu brasilianischen Bürgern
entwickeln würden, bei gleichzeitiger Aufgabe ihrer
indianischen Lebensweise. Er stand damit im Gegensatz zur
herrschenden Meinung, daß der rückständige
lndianer nie zu einem vollwertigen Mitglied der nationalen
Gesellschaft werden könne und seine Vernichtung daher
legitim sei.
Der SPI pazifizierte
Dutzende von indianischen Stämmen und errichtete
lndianerschutzposten. Er war jedoch unfähig, den
Entwicklungsprozeß in der Folgezeit zu kontrollieren.
Vielmehr erleichterte er durch die Befriedung der lndianer das
Vordringen der Weißen.
Als Rondon 1958 starb,
wurde die Leitung Militärs übertragen. Der SPI verkam
zu einer korrupten Organisation. Kriminelle Praktiken innerhalb
des SPI wurden 1967 aufgedeckt, sie reichten von der
Unterschlagung staatlicher Gelder bis zur Beteiligung an Morden
(Dynamitabwürfe auf Indianerdörfer, Verteilung
verseuchter Kleidung und vergifteter Lebensmittel), die ihren
Höhepunkt in den 60er Jahren hatten. Nach der Aufdeckung der
Verbrechen wurde der SPI aufgelöst und 1968 durch die FUNAI
ersetzt.
Ebenso wie der SPI
befriedete die Funai zahlreiche Stämme und sorgte so
dafür, daß die Weißen nur noch auf wenig
Widerstand stießen. Die schlechte medizinische Versorgung
ließ die lndianer massenweise sterben; man konnte dann
getrost einen Teil ihres ehemaligen Territoriums zur
Bewirtschaftung durch Weiße freigeben.
Die Landrechte der
Indianer sind in der brasilianischen Verfassung verankert und
werden auch im Indianer-Statut von 1973 garantiert. Das
lndianer-Statut schreibt vor, daß bis 1978 alle Reservate
vermessen sein sollten; bis 1980 waren von 41 Millionen Ha gerade
13,7 Mio. ha vermessen worden. Es scheint, als habe die FUNAI
eine ausgesprochene Verzögerungstaktik verfolgt. Hatten sich
auf lndianerland erst einmal Unternehmen etabliert, dann konnte
dieses Land eben nicht mehr von Indianer genutzt
werden.
Aus: pogrom 96,
Zeitschrift der GfbV-Deutschland
 Das Massaker
von Haximu
Das Massaker
von Haximu
Bericht über
einen Massenmord
(...) 1993 ist die
Beziehung zwischen den Garimpeiros und den Yanomami am oberen
Orinoko bei Haximu auf dem Tiefstpunkt. Die Yanomami besuchen die
Zeltlager der Garimpeiros häufig und sind aufdringlich. Bei
einem dieser Besuche wurde ihnen von zwei Garimpeiroführern
Hängematten und Kleidung versprochen. Dieses Versprechen
wurde wie viele andere nicht eingehalten. Ein junger
Häuptling suchte daraufhin wütend das Zeltlager der
Goldsucher auf, um sich das Versprochene abzuholen. Es folgte
eine gewalttätige Auseinandersetzung. Die Yanomami verjagten
einen der Angestellten des Garimpeiroführers mit Gewehren,
durchschnitten die Seile der Hängematten der Goldsucher,
warfen Decken und ein Radio in den Wald und nahmen ein paar
Töpfe mit.
(...) Am 15. Juni
kommt eine Gruppe von sechs jungen Yanomami aus Haximu zu einem
Lager der Goldsucher, um Essen, Kleidung und Jagdgewehre zu
erbetteln. Sie erhalten lediglich ein wenig Maniokmehl und einen
Fetzen Papier mit einer Botschaft für andere Garimpeiros
flußabwärts. Die sechs Yanomamimänner gehen zu
diesem Lager, wo eine Gruppe von Garimpeiros Domino spielt. Sie
werden von der Köchin des Lagers empfangen, die den Zettel
liest, ihn ins Feuer wirft und zu den Garimpeiros sagt: "Viel
Spaß mit diesen ldioten." lnformiert und ermutigt durch die
Köchin entschließen sich die Goldsucher, die jungen
Männer sofort zu töten.
Ein unverletzte
Yanomami läuft zu seinem Dorf Haximu und berichtet von dem
Überfall. Nachdem alle Vorbereitungen getroffen sind, macht
sich eine Gruppe von Kriegern aus vier Dörfern auf, um die
Toten zu rächen. Ziel dieser Rachezüge sind immer die
Männer, die die Morde verübt haben, Frauen und Kinder
sind nie das Ziel ihrer Rache. Am 26. Juli haben die Yanomami das
Garimpeirolager erreicht. Die Yanomami greifen an, töten
einen der Goldsucher, der andere wird am Rücken
verwundet.
Die anderen
Garimpeiros sind wütend und planen ihrerseits einen
Rachefeldzug. Sie erreichen Garimpeiros Haximu, finden ein
verwaistes Dorf vor und folgen den Spuren der lndianer. Die
Garimpeiros, die das Lager entdeckten, eröffnen
plötzlich das Feuer aus Jagdgewehren und Revolvern. Einige
Yanomami können fliehen. Die, die geflüchtet sind,
können die Angstschreie von den Opfern und die nicht enden
wollenden Schüsse von den Garimpeiros hören.
Schließlich hören sie auf zu schießen und
töten die noch lebenden Yanomami mit Macheten und Messern.
Sie massakrieren alle Verletzten, sogar einige Kinder, die
unverletzt geblieben waren. 12 Menschen werden umgebracht - drei
Frauen, neun Kinder und Jugendliche.
Aus:
Archivmaterial der GfbV-Deutschland von Bruce Albert,
Anthropologe und ehemaliger Generalsekretär von Survival
International
 "Sie sehen
sie als Tiere, nicht als Menschen"
"Sie sehen
sie als Tiere, nicht als Menschen"
Das Massaker an den
Yanomami hat eine Diskussion ausgelöst: Wieviel Land steht
den Indianern zu?
Die Welle der
Gewalt im Amazonasgebiet hat neben der Scham über das
beschmutzte Ansehen in der Welt aber auch einen heftigen Streit
darüber ausgelöst, wieviel Land den Ureinwohnern
eigentlich zusteht. Nach der brasilianischen Verfassung haben die
etwa 300.000 lndianer, die 0,3 Prozent der Bevölkerung
ausmachen, ein Recht auf zehn Prozent des Staatsgebietes. Das sei
eindeutig zuviel, meint eine Koalition aus Goldgräbern und
Politikern. "Wenn es bei der jetzigen Lage bleibt, bricht die
Wirtschaft des Bundesstaates Roraima zusammen", warnt Ottomar
Pinto, der Gouverneur von Roraima. In dem Land an der Grenze zu
Venezuela leben nicht nur die Yanomami, sondern auch die
Macuxi-Indianer. Die beiden Reservate mit einer Ausdehnung von
insgesamt 107.000 Quadratkilometern machen rund 17 Prozent der
Fläche des Bundesstaates aus.
Gouverneur Pinto will
nicht eher an den Mord an den Yanomami glauben, bevor er nicht
alle Leichen einzeln gezählt hat. "Das Massaker an den
Yanomami ist eine Erfindung von Interessengruppen, die
lndianergebiete markieren wollen", wittert der Politiker. Sein
Amtskollege Jader Barbalho, Gouverneur des Bundesstaates
Para´, begnügt sich nicht mit kuriosen Kommentaren. Er
kündigte an, daß er gegen die Abgrenzung des 49.000
Quadratkilometer umfassenden Reservats der Menkragnoti vor
Gericht ziehen werde.
Amazoniens Gouverneur
Gilberto Mestrinho, in ganz Brasilien dafür bekannt,
daß er bei Wahlen Motorsägen verteilte, gibt sich
versöhnlich. "Wir sind nicht gegen die Abgrenzung von
Indianerreservaten", stellt er klar. Doch man müsse sich
dagegen wehren, wenn in der Größenordnung
übertrieben werde. Außerdem sei es merkwürdig,
daß in den Reservaten immer reiche Rohstoff- und
Edelmetallvorkommen zu finden seien. Mestrinho sieht den Feind
deshalb im Ausland. "Hier in Amazonien darf kein Baum
gefällt oder die reichen Bodenschätze ausgebeutet
werden. Dies sind internationale Auflagen, um unsere
wirtschaftliche Entwicklung zu verhindern", wettert
er.
Tatsache ist,
daß von den insgesarnt 895.000 Quadratkilometern, die in
Brasilien als traditionelle Lebensräume der lndianer gelten,
bereits 560.000 Quadratkilometer als Reservate ausgewiesen sind.
238 Gebiete sind noch nicht markiert. Doch selbst wenn alle
Reservate markiert wären, eine Garantie für ein
sicheres Leben würden sie den Ureinwohnern dennoch nicht
bieten, wie die Wirklichkeit in den schon bestehenden Reservaten
zeigt. Nach Angaben des katholischen lndianerrates Cimi halten
sich in 84 Prozent aller bereits markierten Gebiete
Goldgräber und Holzhändler auf, weil die Bundespolizei
mangels Geld nicht in der Lage ist, die Riesengebiete zu
schützen. "Auch Kleinbauern dringen in der Reservate ein,
weil ihnen aufgrund der enormen Landkonzentration in Brasilien
keine andere Alternative bleibt", heißt es in einer
Schrift, die Cimi anläßlich des UN-Jahres der
indigenen Völker herausgab.
Aus:
GfbV-Unterrichtseinheit "Der hohe Preis des Goldes: Den
Yanomami-Indianer im Amazonas-Regenwald" von Astrid Pange,
Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt (27. August
1993)
 Die unheile
Welt von Glücksrittern, Indianern und
Soldaten
Die unheile
Welt von Glücksrittern, Indianern und
Soldaten
In Brasilien
besteht kaum ein echtes Interesse, die Morde an den Yanomamis
aufzuklären.
(...) Obschon die
Bundespolizei emsig ermittelt, obschon die Armee den Dschungel
nach den Verantwortlichen der Yanomami-Massaker durchkämmt -
der Eindruck mangelnden lnteresses und echten Willens auf
höchster politischer Ebene am Ausfindigmachen der Täter
lasse die blutige Sache wie so viele andere zuvor einfach
versanden, trifft wohl zu: ,,Wir werden nicht zulassen, daß
ein halbes Dutzend lndianer hier den Fortschritt aufhält",
hatte Roraimas Gouverneur Fernando Ramos Pereira schon 1979
proklamiert. Das ist auch die Überzeugung von Elton
Röhnelt, einem an der Goldsucherei reich gewordenen
Südbrasilianers deutscher Abstammung.
lm indianerfreien,
aber längst ausgelaugten ,Serra Pelada" konnte Elton
Röhnelt seinen persönlichen Reibach nie gemacht haben -
dafür ist er entschieden zu jung. Also ,,empfahl" sich der
erfolgreiche Goldschürfer dank einer unbestimmten Anzahl
lndianermorde.
Wo denn, außer
in lndianerreservaten, liegen die ergiebigsten Goldadern
Brasiliens? ,,Hier ein Kraftwerk, dort eine
Straßenverbindung", läßt Röhnelt in seiner
Eigenschaft als Energie-Staatssekretär Roraimas mit
Steuergeldern seit ein paar Jahren bauen - lnfrastruktur für
Schürfkonzerne, die nach Überzeugung des
schwergewichtigen Zeitgenossen ,schon in den kommenden Jahren in
den Yanomami-Reservaten nach Gold suchen werden". "Und dann",
ergänzt er, der seine Hemden in London kaufen
läßt, "bin auch ich wieder dabei".
Kaum jemandem, der in
Brasilien politischen Einfluß hat, will in den Kopf,
daß 9.000 Yanomami ein unantastbares Reservat von der
Ausdehnung Portugals bevölkern dürfen. Dem Militär
paßt das nicht ins Konzept, weil das seine
Bewegungsfreiheit im Grenzgebiet der Amazonasregion
einschränkt. Andererseits macht das Oberkommando keinen Hehl
aus der Sorge über die wachsende soziale Unruhe in
Brasilien. Vom Revolutionstrauma geplagt, sähen es die
Generale nicht ungern, die Brotlosen dorthin zu schicken, wo es
den Reichtum nur auszugraben gilt und Raum in Hülle und
Fülle da ist.
Die Elite des Landes
kleidet ihr Reichtumsstreben in die entwicklungspolitische
Floskel, ein armer Staat wie Brasilien könne es sich nicht
leisten, die unter dem Yanomami-Boden schlummernden
Reichtümer gar nicht erst anzutasten. Die Rechte und die
Armee dringen im Kongreß von Brasilia daher darauf, ein
altes Konzept wieder umzusetzen; nämlich das Reservat der
Yanomami in 19 zum Teil weit auseinanderliegende Urwaldinseln
aufzuteilen und die Zwischenräume dieses Brockens
Schöpfung dem Gewinnstreben der Goldsucher anheimfallen zu
lassen.
Aus:
GfbV-Unterrichtseinheit "Der hohe Preis des Goldes: Den
Yanomami-Indianern im Amazonas-Regenwald droht der Untergang" von
Ulrich Ackermann in der Frankfurter Rundschau
(2.9.93)
Eine
Publikation der Gesellschaft für bedrohte Völker.
Weiterverbreitung bei Nennung der Quelle
erwünscht
Una pubblicazione dell'Associazione per i popoli
minacciati. Si prega di citare la fonte @@@ WebDesign: M.
di Vieste